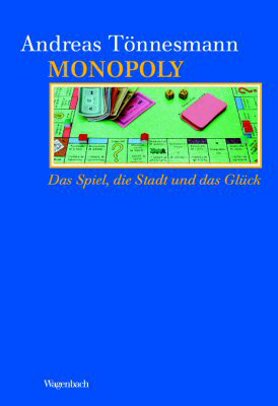Andreas Tönnesmann Monopoly. Das Spiel, die Stadt und das Glück
- Wagenbach Verlag
- Berlin 2011
- ISBN 978-3-8031-5181-0
- 144 Seiten
- Verlagskontakt
Andreas Tönnesmann
Monopoly. Das Spiel, die Stadt und das Glück
Mit Förderung von Litrix.de auf Russisch erschienen.
Buchbesprechung
Alle erfolgreichen Spiele haben gemein, dass sich ihre Grundidee in einem Satz zusammenfassen lässt. Im Fußball gewinnt, wer mehr Tore erzielt als die gegnerische Mannschaft. Beim Schach geht es darum, den König des Kontrahenten schachmatt zu setzen. Und für das meistverkaufte Gesellschaftsspiel aller Zeiten gilt: Solange wie möglich zahlungsfähig zu bleiben, während man seine Gegner in den Bankrott zwingt.
Monopoly – es gibt wahrscheinlich nur wenige Menschen, die noch nie eine Spielfigur über seine Straßen bewegt haben. Die nicht vor einem Hotel auf der Schlossallee gezittert und mit Erleichterung das Gehalt eingestrichen haben, sobald sie über „Los“ gezogen sind. Seit seiner Patentierung am Silvestertag 1935 geht es täglich gut zehntausend Mal über den Ladentisch. Doch woher rührt die Faszination für ein Brettspiel, bei dem sich alles um Grundstücksspekulation dreht?
In seinem Buch Monopoly. Das Spiel, die Stadt und das Glück sucht der Bonner Kunsthistoriker Andreas Tönnesmann nach Antworten. Mit bemerkenswerter Hingabe verknüpft er den historischen Hintergrund mit seiner architekturtheoretischen Interpretation. Idee, Spiel, Stadt lautet sein Dreisprung, den er mit wissenschaftlich hohem Anspruch anschaulich vollführt. Dies liegt nicht allein an den mehr als dreißig Abbildungen, sondern an einer hierzulande seltenen Kombination: Wissenschaftliche Genauigkeit und Tiefe verbinden sich bei dem Professor für Kunst- und Architekturgeschichte mit wohltuender Verständlichkeit und Nonchalance.
Wie Tönnesmann darlegt, ist Monopoly ein Spiel, bei dem derjenige die besten Chancen hat, der Wagemut, Verstand und Optimismus am geschicktesten zu kombinieren weiß. Natürlich spielt der Zufall eine wichtige Rolle, doch braucht es zum Sieg auch ein Verhaltensmuster, das die moderne Psychologie als „feindselig-schädigende Rivalität“ bezeichnet. Das Motto lautet: „einer gegen alle“. Diese Ellbogenmentalität zeichnete auch den Erfinder des Spiels aus: Charles Darrow aus Germantown, Pennsylvania. Ein Heizungsbauer und Installateur Anfang vierzig, der während der Großen Depression wie Millionen anderer Amerikaner seinen Job verlor.
Ein Brettspiel namens „Atlantic City Game“ diente als Zeitvertreib und Vorlage für seine Version, die er in Heimarbeit mit Stichsäge und Pinseln auf Wachstuch herstellte. Straßennamen, Ereigniskarten, Start- und Gefängnisfelder übernahm er einfach. Tönnesmann sieht in Darrow jedoch nicht bloß einen dreisten Plagiator, sondern hebt dessen „Formphantasie“ und Designtalent hervor. Auch wenn seine „Erfindung“ auf diversen Vorläufern beruhte, gab Darrow ihm seinen eingängigen Namen und brachte es zur Marktreife. So wurde ein in Krisenzeiten entwickeltes Brettspiel zum globalen Massenprodukt. Und sein Erfinder schnell zum Millionär.
Im nationalsozialistischen Deutschland konnte sich Monopoly nicht durchsetzen. Dafür wird es in anderen Teilen der Welt umso erfolgreicher. Tönnesmann hebt das scheinbar unbegrenzte Anpassungspotenzial des Spiels hervor, eine wichtige Voraussetzung für seinen globalen Siegeszug, der in Philadelphias Kaufhaus Wanamaker's seinen Ausgang nahm. Sogar im KZ Theresienstadt entstand 1942 eine Version namens „Ghetto“, die heute in der Gedenkstätte Yad Vashem zu sehen ist. Seine Glanzepoche erlebte Monopoly im Kalten Krieg. Während etwa in der DDR striktes Einfuhrverbot herrschte, wurde es im Westen zum Inbegriff des American Way of Life.
Von der Entstehungsgeschichte schlägt Tönnesmann einen Bogen zur Vorstellung der Idealstadt. Zweifellos ein Erzeugnis der Moderne, steht Monopoly für ihn vor allem in der Tradition stadtplanerischer Ideen der Neuzeit. Um dies zu belegen, streift er klassische Beispiele für Idealstädte: Vom Hippodamischen Schema springt er in die Renaissance, zu Filaretes „Sforzinda“ und Thomas Morus' „Utopia“. In diesem Licht erscheint Monopoly als Wunschvorstellung einer Stadt, als „gespielte Utopie“. Diese Linie weiterführend, vergleicht Tönnesmann das Spiel mit Ebenezer Howards Gartenstadt und den urbanen Konzepten des amerikanischen Architekten Frank Lloyd Wright.
Obgleich ein Sinnbild der modernen Stadt, fehlen Monopoly so entscheidende Merkmale wie Kirchen, Krankenhäuser, Schulen, Museen oder Schwimmbäder. Auch produzierende Industrie und Handel sucht man vergebens auf dem Spielbrett, das gleichzeitig Stadtplan ist. Und anders als reale Städte kann man Monopoly nicht verlassen. Nicht einmal die vier Bahnhöfe bieten Ausweichmöglichkeiten – ihre Gleise enden am Spielfeldrand. Klar ist nur die Ideologie: Es herrscht eine liberalistische Wirtschaftspraxis, deren Ziel die Unabhängigkeit des Einzelnen ist. Wucher und eine „bewusst übertriebene Renditepolitik“ bestimmen das Leben der Bewohner von Monopoly. Sein Reiz ist auch gut fünfundsiebzig Jahre nach der Markteinführung ungebrochen, sogar Weltmeisterschaften gibt es. Und während es bereits zu Beginn einen kritischen Kommentar zu Franklin D. Roosevelts Wirtschafts- und Sozialreformen darstellte, hat es auch heute von seiner Aktualität wenig eingebüßt. Denn ganz gleich, was auf dem Spielfeld passiert: Die Bank kann niemals pleitegehen.

Monopoly – es gibt wahrscheinlich nur wenige Menschen, die noch nie eine Spielfigur über seine Straßen bewegt haben. Die nicht vor einem Hotel auf der Schlossallee gezittert und mit Erleichterung das Gehalt eingestrichen haben, sobald sie über „Los“ gezogen sind. Seit seiner Patentierung am Silvestertag 1935 geht es täglich gut zehntausend Mal über den Ladentisch. Doch woher rührt die Faszination für ein Brettspiel, bei dem sich alles um Grundstücksspekulation dreht?
In seinem Buch Monopoly. Das Spiel, die Stadt und das Glück sucht der Bonner Kunsthistoriker Andreas Tönnesmann nach Antworten. Mit bemerkenswerter Hingabe verknüpft er den historischen Hintergrund mit seiner architekturtheoretischen Interpretation. Idee, Spiel, Stadt lautet sein Dreisprung, den er mit wissenschaftlich hohem Anspruch anschaulich vollführt. Dies liegt nicht allein an den mehr als dreißig Abbildungen, sondern an einer hierzulande seltenen Kombination: Wissenschaftliche Genauigkeit und Tiefe verbinden sich bei dem Professor für Kunst- und Architekturgeschichte mit wohltuender Verständlichkeit und Nonchalance.
Wie Tönnesmann darlegt, ist Monopoly ein Spiel, bei dem derjenige die besten Chancen hat, der Wagemut, Verstand und Optimismus am geschicktesten zu kombinieren weiß. Natürlich spielt der Zufall eine wichtige Rolle, doch braucht es zum Sieg auch ein Verhaltensmuster, das die moderne Psychologie als „feindselig-schädigende Rivalität“ bezeichnet. Das Motto lautet: „einer gegen alle“. Diese Ellbogenmentalität zeichnete auch den Erfinder des Spiels aus: Charles Darrow aus Germantown, Pennsylvania. Ein Heizungsbauer und Installateur Anfang vierzig, der während der Großen Depression wie Millionen anderer Amerikaner seinen Job verlor.
Ein Brettspiel namens „Atlantic City Game“ diente als Zeitvertreib und Vorlage für seine Version, die er in Heimarbeit mit Stichsäge und Pinseln auf Wachstuch herstellte. Straßennamen, Ereigniskarten, Start- und Gefängnisfelder übernahm er einfach. Tönnesmann sieht in Darrow jedoch nicht bloß einen dreisten Plagiator, sondern hebt dessen „Formphantasie“ und Designtalent hervor. Auch wenn seine „Erfindung“ auf diversen Vorläufern beruhte, gab Darrow ihm seinen eingängigen Namen und brachte es zur Marktreife. So wurde ein in Krisenzeiten entwickeltes Brettspiel zum globalen Massenprodukt. Und sein Erfinder schnell zum Millionär.
Im nationalsozialistischen Deutschland konnte sich Monopoly nicht durchsetzen. Dafür wird es in anderen Teilen der Welt umso erfolgreicher. Tönnesmann hebt das scheinbar unbegrenzte Anpassungspotenzial des Spiels hervor, eine wichtige Voraussetzung für seinen globalen Siegeszug, der in Philadelphias Kaufhaus Wanamaker's seinen Ausgang nahm. Sogar im KZ Theresienstadt entstand 1942 eine Version namens „Ghetto“, die heute in der Gedenkstätte Yad Vashem zu sehen ist. Seine Glanzepoche erlebte Monopoly im Kalten Krieg. Während etwa in der DDR striktes Einfuhrverbot herrschte, wurde es im Westen zum Inbegriff des American Way of Life.
Von der Entstehungsgeschichte schlägt Tönnesmann einen Bogen zur Vorstellung der Idealstadt. Zweifellos ein Erzeugnis der Moderne, steht Monopoly für ihn vor allem in der Tradition stadtplanerischer Ideen der Neuzeit. Um dies zu belegen, streift er klassische Beispiele für Idealstädte: Vom Hippodamischen Schema springt er in die Renaissance, zu Filaretes „Sforzinda“ und Thomas Morus' „Utopia“. In diesem Licht erscheint Monopoly als Wunschvorstellung einer Stadt, als „gespielte Utopie“. Diese Linie weiterführend, vergleicht Tönnesmann das Spiel mit Ebenezer Howards Gartenstadt und den urbanen Konzepten des amerikanischen Architekten Frank Lloyd Wright.
Obgleich ein Sinnbild der modernen Stadt, fehlen Monopoly so entscheidende Merkmale wie Kirchen, Krankenhäuser, Schulen, Museen oder Schwimmbäder. Auch produzierende Industrie und Handel sucht man vergebens auf dem Spielbrett, das gleichzeitig Stadtplan ist. Und anders als reale Städte kann man Monopoly nicht verlassen. Nicht einmal die vier Bahnhöfe bieten Ausweichmöglichkeiten – ihre Gleise enden am Spielfeldrand. Klar ist nur die Ideologie: Es herrscht eine liberalistische Wirtschaftspraxis, deren Ziel die Unabhängigkeit des Einzelnen ist. Wucher und eine „bewusst übertriebene Renditepolitik“ bestimmen das Leben der Bewohner von Monopoly. Sein Reiz ist auch gut fünfundsiebzig Jahre nach der Markteinführung ungebrochen, sogar Weltmeisterschaften gibt es. Und während es bereits zu Beginn einen kritischen Kommentar zu Franklin D. Roosevelts Wirtschafts- und Sozialreformen darstellte, hat es auch heute von seiner Aktualität wenig eingebüßt. Denn ganz gleich, was auf dem Spielfeld passiert: Die Bank kann niemals pleitegehen.

Von Daniel Grinsted
Daniel Grinsted ist Kulturwissenschaftler und Anglist/Amerikanist. Er arbeitet als freier Kulturjournalist für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Zeit Online, Literaturen, das Börsenblatt und andere Medien.