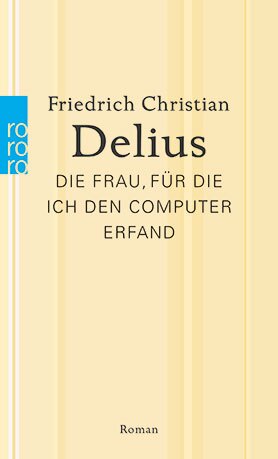Friedrich Christian Delius Die Frau, für die ich den Computer erfand
- Rowohlt Buchverlag
- Berlin 2009
- ISBN 978-3-87134-642-2
- 288 Seiten
- Verlagskontakt
Friedrich Christian Delius
Die Frau, für die ich den Computer erfand
Dieses Buch wurde vorgestellt im Rahmen des Schwerpunkts Spanisch: Argentinien (2009 - 2011).
Leseproben
Buchbesprechung
An einem heißen Tag im Juli 1994 treffen sich Konrad Zuse und ein Journalist zu einem ganz besonderen Interview auf der Terrasse eines abgelegenen Berggasthofes im Rhöngebirge. Eine Nacht soll das Gespräch dauern, so die Vereinbarung. In diesen Stunden will Zuse, Pionier der deutschen Computertechnik und mittlerweile 84 Jahre alt, so offen wie nie zuvor die Geschichte seines langen und bewegten Lebens erzählen – und dabei auch sein besonderes Verhältnis zu Ada Lovelace nicht aussparen, der Frau, für die er den Computer erfand. Das ist die Rahmenhandlung des neuen Romans von Friedrich Christian Delius. Die auf einer halben Seite eingeleitete Binnenhandlung und Ich-Erzählung von Konrad Zuse umfasst nahezu den gesamten Roman. In ihr berichtet Konrad Zuse in lockerem und eigenwilligem Ton, wie er in den 30er und 40erJahren des 20. Jahrhunderts in seiner Wohnung in Kreuzberg den ersten funktionsfähigen Computer baute, welche Auswirkungen die nationalsozialistische Herrschaft auf sein Leben als Erfinder hatte und wie er seinen Rechner schließlich vor den Bomben der Alliierten in Sicherheit bringen konnte. Die Frau, für die ich den Computer erfand ist ein Roman, der auf unkonventionelle und geistreiche Weise die Figur des Konrad Zuse zur Schnittstelle einer Erzählung von persönlicher und allgemeiner Geschichte macht.
Der historische Konrad Zuse (1910–1995) hat die Z3 (im Roman A3), den ersten auf dem binären System basierenden Computer, während des Zweiten Weltkriegs in seiner Privatwohnung in Berlin fernab des wissenschaftlichen Betriebs gebaut. Dennoch hat er seit 1936 in zahlreichen Unterlagen seine Erfindungen und Patententwürfe dokumentiert. Über die unmittelbare technische Arbeit hinaus reflektiert er in ihnen schon früh mögliche gesellschaftliche Funktionen, die seine Erfindung, der Computer, übernehmen könnte. Der Roman Die Frau, für die ich den Computer erfand schreibt diesen Diskurs fort und erweitert ihn mit den Mitteln des Fiktiven.
Es ist der Abend, an dem ihm eigentlich die Ehrendoktorwürde der Universität Braunschweig verliehen werden sollte. Doch der Titel – es ist bereits sein 14. – ist ihm gleichgültig, zu viele Lobreden hat der Erzähler in seinem Leben schon gehört, zu viele Dankesreden gehalten. Sprechen möchte er an diesem Julitag des Jahres 1994 aber doch: „Keine Frackrede, keine Krawattenrede, sondern eher im Arbeitskittel, verstehen Sie?” Im „Arbeitskittel” zu sprechen heißt, keine Rücksicht zu nehmen auf Regeln und Etiketten, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und „endlich mal alles ganz anders erzählen [...], so erzählen [...], wie es wirklich gewesen ist und wie ich mit dem Faust in meiner Brust umgegangen bin und wie mit Ada, genau das ist meine Art, dem Rest der Welt die Zunge rauszustrecken.” Für den 84-jährigen Konrad Zuse ist das Gespräch ein Befreiungsschlag und zugleich ein Akt des Abschiednehmens. Auch weiterhin, so räsonniert er, gibt es im Bereich der digitalen Technik unzählige Probleme, die es zu lösen gilt, allen voran auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz, wo das vielfach vernetzte menschliche Denken in binäre Codes übersetzt werden muss. „Ungelöste Fragen, jede Menge ... Ich muss mich nicht mehr damit herumschlagen! Ein schönes Gefühl! Eine Befreiung! Sechzig Jahre linear und logisch denken sind genug! Einfach reden, wie das Gehirn gewachsen ist oder meinetwegen der Schnabel ...”
Für ihn ist es nun Zeit zurückzuschauen. Zuse erzählt, wie er nach seinem Ingenieursstudium in Berlin bei den Henschel-Flugzeugwerken zu arbeiten beginnt. Doch bereits zuvor war in ihm der Gedanke gereift, eine Rechenmaschine zu konstruieren, die ihm die mühevolle und sich laufend wiederholende Rechenarbeit abnehmen könnte. Zuse, ein Tüftler, der zu diesem Zeitpunkt schon andere Dinge wie einen Warenautomaten mit Geldrückgabe oder ein automatisches Fotolabor entwickelt hatte, beginnt mit der Arbeit an der A1, einer digitalen Rechenmaschine und dem Vorläufer des ersten funktionsfähigen Computers, der A3. Als er sie 1938 fertig gestellt hat, ahnt in Deutschland niemand, dass diese Geräte die Welt bahnbrechend verändern sollen. Deutschland war unter den Nationalsozialisten international isoliert und Zuse daher abgeschnitten von den Forschungen auf dem Gebiet der Computertechnik, die zur gleichen Zeit in den USA große Fortschritte machten. 1939 wird Zuse zum Wehrdienst einberufen, jedoch bereits nach kurzer Zeit wieder „unabkömmlich” gestellt und kann so weiter an seinen Erfindungen arbeiten.
Zu seiner Rolle im nationalsozialistischen Regime bekennt er: „Ich hatte überhaupt keine Zeit, ein Antinazi zu sein, könnte ich jetzt sagen. Natürlich war einer wie ich fasziniert von den technischen Möglichkeiten, die das neue Regime mit sich brachte [...]. Ich war ein Mitläufer und ich bekenne mich dazu.” Im Gegensatz zu seinem Kollegen und Zeitgenossen Wernher von Braun blieb die Wertschätzung der Leistungen Konrad Zuses durch die Nationalsozialisten jedoch aus. Nachdem die A3 1945 bei einem Bombenanschlag zerstört worden ist, flüchtet Konrad Zuse mit der weiter entwickelten A4 von Berlin in ein kleines Bergdorf in Süddeutschland, um sie dort vor den Alliierten zu verstecken. Das gelingt ihm, doch auch nach dem Zweiten Weltkrieg bleibt ihm die Anerkennung seiner Arbeit zunächst versagt. Erst 1949, nach einer Präsentation der A4 an der Technischen Hochschule Zürich, wird die Welt auf den Erfinder aufmerksam. Da waren seine Kollegen aus den USA jedoch schon mit ihren Erfindungen an die Öffentlichkeit gegangen.
Die Enttäuschung über die lange ausgebliebene angemessene Würdigung seiner Leistung ist dem Ich-Erzähler deutlich anzumerken. Immer wieder kommt er auf sie zu sprechen. Chronologisch kann sein Bericht ohnehin kaum genannt werden. Zwar ist die zeitliche Reihenfolge der Ereignisse größtenteils eingehalten, jedoch machen Reflexionen über Themen wie Gesellschaft, Liebe und Technik einen großen Teil der Erzählung aus. Obwohl Zuses Geschichte aus einem Interview entstanden ist, liest sie sich wie ein Monolog, denn die Fragen des Journalisten werden nicht wiedergegeben und sind nur durch Auslassungszeichen gekennzeichnet. Dadurch entsteht ein offener Text, der vom frischen und lebendigen Rhythmus der gesprochenen Sprache geprägt ist. Dieser eigenwillige Ton ist charakteristisch für den Roman und entspricht ganz dem von Zuse favorisierten Sprechen im „Arbeitskittel“.
Dass die Erzählung trotzdem an keiner Stelle zu zerfasern droht, liegt vor allem am geschickten Einsatz diverser Leitmotive, die die Geschichte und das Leben des Protagonisten durchziehen. Eines davon ist das Gesetz des binären Codes, auf dem jeder Computer basiert und das sich verschiedenartig ausprägt: Der Strom fließt, oder er fließt nicht. Es liegt eine positive Spannung an oder eine negative. Ein weiteres wichtiges Leitmotiv findet der kunstinteressierte Erzähler bei Goethe: Es ist das Faustische, das in seinem Leben für das Streben nach vorne und für die Lust am Erfinden steht. Für Zuse ist es eng verbunden mit dem Prinzip der Liebe, von dem es in GoethesFaust heißt: „Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan“. Damit ist schließlich Ada Lovelace gemeint. Die Intelligenz und der Erfindergeist der 1852 verstorbenen Britin, die auch als erste Programmiererin bezeichnet wird und nach der die Programmiersprache „Ada“ benannt ist, weckte Zuses Leidenschaft und hielt sie über Jahrzehnte hinweg aufrecht.
So verschränken sich in Die Frau, für die ich den Computer erfand Fiktion und Dokumentation auf beeindruckende Weise. Der Roman führt vor, wie sich einerseits die Geschichte in der Person des Konrad Zuse widerspiegelt. Andererseits ist er das Porträt eines Mannes, dessen Erfindung wiederum die Gesellschaft grundlegend verändert hat. Durch die Subjektivität der Perspektive gerät das Buch jedoch an keiner Stelle zu einem kulturgeschichtlichen Essay, sondern erzählt unverkrampft und unterhaltsam die Lebensgeschichte eines bemerkenswerten Mannes.

Der historische Konrad Zuse (1910–1995) hat die Z3 (im Roman A3), den ersten auf dem binären System basierenden Computer, während des Zweiten Weltkriegs in seiner Privatwohnung in Berlin fernab des wissenschaftlichen Betriebs gebaut. Dennoch hat er seit 1936 in zahlreichen Unterlagen seine Erfindungen und Patententwürfe dokumentiert. Über die unmittelbare technische Arbeit hinaus reflektiert er in ihnen schon früh mögliche gesellschaftliche Funktionen, die seine Erfindung, der Computer, übernehmen könnte. Der Roman Die Frau, für die ich den Computer erfand schreibt diesen Diskurs fort und erweitert ihn mit den Mitteln des Fiktiven.
Es ist der Abend, an dem ihm eigentlich die Ehrendoktorwürde der Universität Braunschweig verliehen werden sollte. Doch der Titel – es ist bereits sein 14. – ist ihm gleichgültig, zu viele Lobreden hat der Erzähler in seinem Leben schon gehört, zu viele Dankesreden gehalten. Sprechen möchte er an diesem Julitag des Jahres 1994 aber doch: „Keine Frackrede, keine Krawattenrede, sondern eher im Arbeitskittel, verstehen Sie?” Im „Arbeitskittel” zu sprechen heißt, keine Rücksicht zu nehmen auf Regeln und Etiketten, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und „endlich mal alles ganz anders erzählen [...], so erzählen [...], wie es wirklich gewesen ist und wie ich mit dem Faust in meiner Brust umgegangen bin und wie mit Ada, genau das ist meine Art, dem Rest der Welt die Zunge rauszustrecken.” Für den 84-jährigen Konrad Zuse ist das Gespräch ein Befreiungsschlag und zugleich ein Akt des Abschiednehmens. Auch weiterhin, so räsonniert er, gibt es im Bereich der digitalen Technik unzählige Probleme, die es zu lösen gilt, allen voran auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz, wo das vielfach vernetzte menschliche Denken in binäre Codes übersetzt werden muss. „Ungelöste Fragen, jede Menge ... Ich muss mich nicht mehr damit herumschlagen! Ein schönes Gefühl! Eine Befreiung! Sechzig Jahre linear und logisch denken sind genug! Einfach reden, wie das Gehirn gewachsen ist oder meinetwegen der Schnabel ...”
Für ihn ist es nun Zeit zurückzuschauen. Zuse erzählt, wie er nach seinem Ingenieursstudium in Berlin bei den Henschel-Flugzeugwerken zu arbeiten beginnt. Doch bereits zuvor war in ihm der Gedanke gereift, eine Rechenmaschine zu konstruieren, die ihm die mühevolle und sich laufend wiederholende Rechenarbeit abnehmen könnte. Zuse, ein Tüftler, der zu diesem Zeitpunkt schon andere Dinge wie einen Warenautomaten mit Geldrückgabe oder ein automatisches Fotolabor entwickelt hatte, beginnt mit der Arbeit an der A1, einer digitalen Rechenmaschine und dem Vorläufer des ersten funktionsfähigen Computers, der A3. Als er sie 1938 fertig gestellt hat, ahnt in Deutschland niemand, dass diese Geräte die Welt bahnbrechend verändern sollen. Deutschland war unter den Nationalsozialisten international isoliert und Zuse daher abgeschnitten von den Forschungen auf dem Gebiet der Computertechnik, die zur gleichen Zeit in den USA große Fortschritte machten. 1939 wird Zuse zum Wehrdienst einberufen, jedoch bereits nach kurzer Zeit wieder „unabkömmlich” gestellt und kann so weiter an seinen Erfindungen arbeiten.
Zu seiner Rolle im nationalsozialistischen Regime bekennt er: „Ich hatte überhaupt keine Zeit, ein Antinazi zu sein, könnte ich jetzt sagen. Natürlich war einer wie ich fasziniert von den technischen Möglichkeiten, die das neue Regime mit sich brachte [...]. Ich war ein Mitläufer und ich bekenne mich dazu.” Im Gegensatz zu seinem Kollegen und Zeitgenossen Wernher von Braun blieb die Wertschätzung der Leistungen Konrad Zuses durch die Nationalsozialisten jedoch aus. Nachdem die A3 1945 bei einem Bombenanschlag zerstört worden ist, flüchtet Konrad Zuse mit der weiter entwickelten A4 von Berlin in ein kleines Bergdorf in Süddeutschland, um sie dort vor den Alliierten zu verstecken. Das gelingt ihm, doch auch nach dem Zweiten Weltkrieg bleibt ihm die Anerkennung seiner Arbeit zunächst versagt. Erst 1949, nach einer Präsentation der A4 an der Technischen Hochschule Zürich, wird die Welt auf den Erfinder aufmerksam. Da waren seine Kollegen aus den USA jedoch schon mit ihren Erfindungen an die Öffentlichkeit gegangen.
Die Enttäuschung über die lange ausgebliebene angemessene Würdigung seiner Leistung ist dem Ich-Erzähler deutlich anzumerken. Immer wieder kommt er auf sie zu sprechen. Chronologisch kann sein Bericht ohnehin kaum genannt werden. Zwar ist die zeitliche Reihenfolge der Ereignisse größtenteils eingehalten, jedoch machen Reflexionen über Themen wie Gesellschaft, Liebe und Technik einen großen Teil der Erzählung aus. Obwohl Zuses Geschichte aus einem Interview entstanden ist, liest sie sich wie ein Monolog, denn die Fragen des Journalisten werden nicht wiedergegeben und sind nur durch Auslassungszeichen gekennzeichnet. Dadurch entsteht ein offener Text, der vom frischen und lebendigen Rhythmus der gesprochenen Sprache geprägt ist. Dieser eigenwillige Ton ist charakteristisch für den Roman und entspricht ganz dem von Zuse favorisierten Sprechen im „Arbeitskittel“.
Dass die Erzählung trotzdem an keiner Stelle zu zerfasern droht, liegt vor allem am geschickten Einsatz diverser Leitmotive, die die Geschichte und das Leben des Protagonisten durchziehen. Eines davon ist das Gesetz des binären Codes, auf dem jeder Computer basiert und das sich verschiedenartig ausprägt: Der Strom fließt, oder er fließt nicht. Es liegt eine positive Spannung an oder eine negative. Ein weiteres wichtiges Leitmotiv findet der kunstinteressierte Erzähler bei Goethe: Es ist das Faustische, das in seinem Leben für das Streben nach vorne und für die Lust am Erfinden steht. Für Zuse ist es eng verbunden mit dem Prinzip der Liebe, von dem es in GoethesFaust heißt: „Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan“. Damit ist schließlich Ada Lovelace gemeint. Die Intelligenz und der Erfindergeist der 1852 verstorbenen Britin, die auch als erste Programmiererin bezeichnet wird und nach der die Programmiersprache „Ada“ benannt ist, weckte Zuses Leidenschaft und hielt sie über Jahrzehnte hinweg aufrecht.
So verschränken sich in Die Frau, für die ich den Computer erfand Fiktion und Dokumentation auf beeindruckende Weise. Der Roman führt vor, wie sich einerseits die Geschichte in der Person des Konrad Zuse widerspiegelt. Andererseits ist er das Porträt eines Mannes, dessen Erfindung wiederum die Gesellschaft grundlegend verändert hat. Durch die Subjektivität der Perspektive gerät das Buch jedoch an keiner Stelle zu einem kulturgeschichtlichen Essay, sondern erzählt unverkrampft und unterhaltsam die Lebensgeschichte eines bemerkenswerten Mannes.

Von Eva Kaufmann