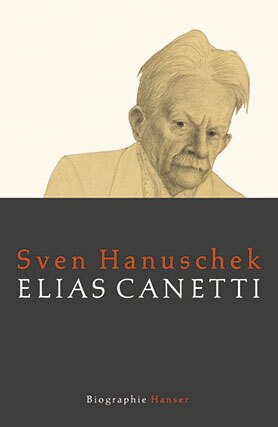Sven Hanuschek Elias Canetti
- Carl Hanser Verlag
- München 2005
- ISBN 3-446-20584-5
- 800 Seiten
- Verlagskontakt
Sven Hanuschek
Elias Canetti
Dieses Buch wurde vorgestellt im Rahmen des Schwerpunkts Chinesisch (2005 - 2006).
Leseproben
Buchbesprechung
„Der Künstler hat nur die Wahl, ob er als Mensch existieren will oder als Werk“, notierte Arno Schmidt einmal, „im zweiten Fall besieht man sich den defekten Rest besser nicht: man hektokotolysiert ein Bruchstück nach dem andern, und löst sich so langsam auf.“ Äußerungen wie diese, mit denen sich Künstler jeglicher biografischer Zudringlichkeit von vornherein zu erwehren suchen und den Neugierigen auf ihr Werk verweisen, sind keine Seltenheit. Abhalten können sie Biografen aber dennoch nicht.
Der 1964 geborene Münchner Germanist Sven Hanuschek, 1999 bereits mit einer umfangreichen und vielgelobten Biografie des Schriftstellers Erich Kästner hervorgetreten, hat sich jetzt im Falle des Literaturnobelpreisträgers Elias Canetti (1905-1994) gleichwohl daran gemacht, diesen „defekten Rest“ unter ein Vergrößerungsglas zu legen und rechtzeitig zu Canettis 100. Geburtstag eine dickleibige Biografie vorgelegt. Es ist die erste Biographie über den großen Dichter, der zwar schon 1935 mit seinem ersten und einzigen Roman Die Blendung an die Öffentlichkeit trat, jedoch erst 1972 mit der Verleihung des Büchnerpreises und 1981 nach Erhalt des Literaturnobelpreises zu Weltruhm gelangte. Mit Arno Schmidt und zahlreichen anderen Kollegen seines Fachs teilte Canetti die Skepsis gegenüber der Gattung der Lebensbeschreibung . Er hatte viele Vorbehalte gegen Biografien, zumal gegen solche, die ihn selbst zum Gegenstand haben sollten; noch in den achtziger Jahren wußte er den Versuch einer Publizistin zu unterbinden und verfügte in seinem Testament, eine Beschreibung seines Lebens dürfe frühestens zehn Jahre nach seinem Tod erscheinen.
Vor diesem Hintergrund erscheint bereits das Verfassen seiner großen, dreibändigen Biografie wie ein Akt der Kontrolle über das eigene Bild. Zudem fürchtete Canetti, wie er in seinen Aufzeichnungen festhielt, die „Übersetzung in Germanistik“; wissenschaftliche Interpretationen hielt er für ein trauriges und den Gegenstand verfehlendes Geschäft. Außerdem hatte er gegen Biografien im engeren Sinne einzuwenden, daß sie überwiegend von einiger psychologischer Simplizität seien und an die treffsicheren Beobachtungen seiner eigenen Porträts, wie sie in den Autobiographie-Bänden in großer Zahl zu finden sind, nicht heranreichten.
Keine leichte Hypothek also für Hanuschek, der sich seinem Gegenstand jedoch mit großem Feingefühl, feinnervigster Werkkenntnis und ebensolcher Skepsis wie Canetti selbst gegenüber dem Genre so vorzüglich gestaltet, wie es nur irgend denkbar ist. Neben dem gedruckten Oeuvre Canettis ist es vor allem der riesige, größtenteils unveröffentlichte Nachlaß, die Innenseite der großenteils bekannten Publikationsgeschichte, die Hanuschek für seine Darstellung nutzt. Eine schwierige Aufgabe angesichts der dreibändigen Geschichte der ersten Hälfte seines Lebens, die Canetti selbst vorgelegt hat, angesichts des riesigen Gebirges seines bis ins Jahr 2024 gesperrten Nachlasses, der kaum zu entziffernden Kurzschrift seiner seit 1942 täglich weitergeführten Aufzeichnungen und nicht zuletzt der Vielsprachigkeit des kosmopolitischen Autors und seiner untergegangenen Muttersprache Ladino. „Canetti wird sich nicht fassen lassen“, konstatiert Hanuschek lakonisch und macht sich ans Werk.
Ein zentraler Begriff in Canettis Leben und Werk ist die „Verwandlung“. Ein Dichter habe „Hüter der Verwandlungen“ zu sein und solle sich das „literarische Erbe der Menschheit zu eigen machen, das an Verwandlungen reich ist“, hielt Canetti in seiner Rede „Der Beruf des Dichters“ im Jahr 1976 fest. Zeitlebens stand diese Vokabel im Zentrum seiner Selbstverständigung, immer wieder aufgeladen von und ausgerichtet am Gründungspunkt aller literarischen Verwandlungs-Erzählungen, an Ovids Metamorphosen. Wenn Canetti den Dichter als Hüter der Verwandlungen beschreibt, hat er dabei vor allem dessen eigene Verwandlungsfähigkeit im Sinn, die es in einer Welt der Spezialisierungen, der Arbeitsteilung zu bewahren gelte gegen eine Produktion, die, so hält Canetti fest, „bedenkenlos die Mittel zu ihrer Selbstzerstörung vervielfältigt und gleichzeitig zu ersticken sucht, was an früher erworbenen Qualitäten des Menschen noch vorhanden wäre“.
Eben diesen Verwandlungen des Dichters Canetti, als Kind sephardischer Juden im bulgarischen Rustschuk geboren, folgt Hanuschek, ohne sich jedoch ausschließlich an den Fluchtlinien der Autobiographie entlang zu bewegen. Glücklicherweise versucht Hanuschek erst gar nicht, die Selberlebensbeschreibung Canettis, die längst zu den großen Autobiografien des 20. Jahrhunderts gehört, nachzuerzählen oder gar mit ihr zu konkurrieren. Vielmehr wahrt er eine kritische Distanz zu seinem Gegenstand und betrachtet die Selbstdarstellung seines Autors im Gegenlicht seiner eigenen jahrelangen Recherchen, Gespräche und Quellenstudien, zumal auch nur der erste Band von Canettis Text Autobiographie im eigentlichen Sinne sei: „In den Folgebänden verschwindet das autobiographische Subjekt mehr und mehr zugunsten eines beinah allwissenden Wahrnehmungszentrums“, so stellt Hanuschek fest, „über das wir so viel gar nicht erfahren.“ Mit feiner Hand steuert Hanuschek hier gegen die Dynamik von Canettis „fiktionalisierenden Erzählstrategien“ und schildert ohne Bruch auch von dem Zeitpunkt an, da er nicht mehr auf die niedergelegten Erinnerungen seines Gegenstandes bauen kann, die von ihm ausgeforschten Lebenswege Canettis.
So entsteht auch und gerade in der Auseinandersetzung mit den Gegenstimmen und alternativen Perspektiven der Freunde und Bekannten das Lebensbild eines Schriftstellers, das den ebenso scharfsinnigen wie scharfzüngigen Porträts, die der „Menschenfresser“ Canetti anzufertigen wußte, an Präzision und Hellsicht in nichts nachsteht, jedoch gerade auf deren oft allzu große Schonungslosigkeit verzichtet. In den Mittelpunkt rückt Hanuschek entsprechend den Roman Canettis, seine Theaterstücke, natürlich die Autobiographie, das von Canetti selbst als opus magnum angesehene Hauptwerk Masse und Macht (1960) und das kaum zu übersehende „Zentralmassiv“ der Aufzeichnungen, von denen erst ein paar auslesehafte Bände veröffentlicht sind.
Dagegen tritt die Schilderung von Canettis vielen, kaum zu überschauenden Liebesbeziehungen angenehm zurück. Sie ist bei Hanuschek von einer Noblesse und Diskretion geprägt, die manchen Leser enttäuschen mag, den vornehmlich am schriftstellerischen Werk interessierten Beobachter aber wohltuend unbehelligt läßt von einem Enthüllungsgeschrei, das naturgemäß die ernsthafte Lektüre eines Lebenswerks zu überlagern droht. Hier gilt die Aufmerksamkeit des Biografen in erster Linie natürlich dem Verhältnis zwischen Canetti und seiner vergötterten ersten Frau Veza Taubner-Calderon – ihre Ehe dauerte von 1934 bis zu ihrem Tod 1963 –, deren Schriftstellertum Canetti in seiner Autobiographie seltsamerweise gänzlich verschwiegen und deren Entdeckung als Autorin er in seinen letzten Lebensjahren beglückt verfolgt hat.
Dieser ebenso wie Canettis zweiter Ehe (1971-1988) mit Hera Buschor, einer 1933 geborenen Restauratorin, die der Dichter seit Mitte der fünfziger Jahre kannte, aber auch den Affären mit Friedl Benedikt und der Malerin Marie-Louise von Motesiczky folgt Hanuschek im Licht von Canettis weitverzweigten „paarkritischen Aufzeichnungen“. Veza, Friedl und Marie-Louise waren für Canetti, der seine eigene Familie größtenteils verloren hatte, vor allem im Londoner Exil seit Ende der dreißiger Jahre jenseits aller erotischen Verstrickungen eine neue Familie, mit der er in wechselnden Konstellationen – am Ende, nach Heras Krebstod 1988 mit der gemeinsamen Tochter Johanna, zusammenlebte.
Lebendig, gleichwohl gänzlich unprätentiös zeichnet Hanuschek hier die verschiedenen Lebens- und Werklinien auf und verliert sich dabei weder in theoretischen Diskursen noch in wüsten Spekulationen. Der Befürchtung Canettis vor der „Übersetzung“ seiner Person „in Germanistik“ entgeht Hanuschek durch seine Sachlichkeit und Zurückhaltung, ohne dabei den Gegenstand unter dem Glassturz bloßer Verehrung zu konservieren. Im Epilog seiner Biografie läßt er dem Dichter das letzte Wort und zitiert dessen Liebeserklärung an seine zweite Frau Hera und die gemeinsame Tochter, für die er sein früheres Leben aufgeschrieben hat: „Johanna werde ich Geschichten erzählen, wann immer sie es sich wünscht. Hera soll mir jede mißtrauische Regung vergeben, ich wollte, daß alles zwischen uns vollkommen ist, und vollkommen ist es geworden.“

Der 1964 geborene Münchner Germanist Sven Hanuschek, 1999 bereits mit einer umfangreichen und vielgelobten Biografie des Schriftstellers Erich Kästner hervorgetreten, hat sich jetzt im Falle des Literaturnobelpreisträgers Elias Canetti (1905-1994) gleichwohl daran gemacht, diesen „defekten Rest“ unter ein Vergrößerungsglas zu legen und rechtzeitig zu Canettis 100. Geburtstag eine dickleibige Biografie vorgelegt. Es ist die erste Biographie über den großen Dichter, der zwar schon 1935 mit seinem ersten und einzigen Roman Die Blendung an die Öffentlichkeit trat, jedoch erst 1972 mit der Verleihung des Büchnerpreises und 1981 nach Erhalt des Literaturnobelpreises zu Weltruhm gelangte. Mit Arno Schmidt und zahlreichen anderen Kollegen seines Fachs teilte Canetti die Skepsis gegenüber der Gattung der Lebensbeschreibung . Er hatte viele Vorbehalte gegen Biografien, zumal gegen solche, die ihn selbst zum Gegenstand haben sollten; noch in den achtziger Jahren wußte er den Versuch einer Publizistin zu unterbinden und verfügte in seinem Testament, eine Beschreibung seines Lebens dürfe frühestens zehn Jahre nach seinem Tod erscheinen.
Vor diesem Hintergrund erscheint bereits das Verfassen seiner großen, dreibändigen Biografie wie ein Akt der Kontrolle über das eigene Bild. Zudem fürchtete Canetti, wie er in seinen Aufzeichnungen festhielt, die „Übersetzung in Germanistik“; wissenschaftliche Interpretationen hielt er für ein trauriges und den Gegenstand verfehlendes Geschäft. Außerdem hatte er gegen Biografien im engeren Sinne einzuwenden, daß sie überwiegend von einiger psychologischer Simplizität seien und an die treffsicheren Beobachtungen seiner eigenen Porträts, wie sie in den Autobiographie-Bänden in großer Zahl zu finden sind, nicht heranreichten.
Keine leichte Hypothek also für Hanuschek, der sich seinem Gegenstand jedoch mit großem Feingefühl, feinnervigster Werkkenntnis und ebensolcher Skepsis wie Canetti selbst gegenüber dem Genre so vorzüglich gestaltet, wie es nur irgend denkbar ist. Neben dem gedruckten Oeuvre Canettis ist es vor allem der riesige, größtenteils unveröffentlichte Nachlaß, die Innenseite der großenteils bekannten Publikationsgeschichte, die Hanuschek für seine Darstellung nutzt. Eine schwierige Aufgabe angesichts der dreibändigen Geschichte der ersten Hälfte seines Lebens, die Canetti selbst vorgelegt hat, angesichts des riesigen Gebirges seines bis ins Jahr 2024 gesperrten Nachlasses, der kaum zu entziffernden Kurzschrift seiner seit 1942 täglich weitergeführten Aufzeichnungen und nicht zuletzt der Vielsprachigkeit des kosmopolitischen Autors und seiner untergegangenen Muttersprache Ladino. „Canetti wird sich nicht fassen lassen“, konstatiert Hanuschek lakonisch und macht sich ans Werk.
Ein zentraler Begriff in Canettis Leben und Werk ist die „Verwandlung“. Ein Dichter habe „Hüter der Verwandlungen“ zu sein und solle sich das „literarische Erbe der Menschheit zu eigen machen, das an Verwandlungen reich ist“, hielt Canetti in seiner Rede „Der Beruf des Dichters“ im Jahr 1976 fest. Zeitlebens stand diese Vokabel im Zentrum seiner Selbstverständigung, immer wieder aufgeladen von und ausgerichtet am Gründungspunkt aller literarischen Verwandlungs-Erzählungen, an Ovids Metamorphosen. Wenn Canetti den Dichter als Hüter der Verwandlungen beschreibt, hat er dabei vor allem dessen eigene Verwandlungsfähigkeit im Sinn, die es in einer Welt der Spezialisierungen, der Arbeitsteilung zu bewahren gelte gegen eine Produktion, die, so hält Canetti fest, „bedenkenlos die Mittel zu ihrer Selbstzerstörung vervielfältigt und gleichzeitig zu ersticken sucht, was an früher erworbenen Qualitäten des Menschen noch vorhanden wäre“.
Eben diesen Verwandlungen des Dichters Canetti, als Kind sephardischer Juden im bulgarischen Rustschuk geboren, folgt Hanuschek, ohne sich jedoch ausschließlich an den Fluchtlinien der Autobiographie entlang zu bewegen. Glücklicherweise versucht Hanuschek erst gar nicht, die Selberlebensbeschreibung Canettis, die längst zu den großen Autobiografien des 20. Jahrhunderts gehört, nachzuerzählen oder gar mit ihr zu konkurrieren. Vielmehr wahrt er eine kritische Distanz zu seinem Gegenstand und betrachtet die Selbstdarstellung seines Autors im Gegenlicht seiner eigenen jahrelangen Recherchen, Gespräche und Quellenstudien, zumal auch nur der erste Band von Canettis Text Autobiographie im eigentlichen Sinne sei: „In den Folgebänden verschwindet das autobiographische Subjekt mehr und mehr zugunsten eines beinah allwissenden Wahrnehmungszentrums“, so stellt Hanuschek fest, „über das wir so viel gar nicht erfahren.“ Mit feiner Hand steuert Hanuschek hier gegen die Dynamik von Canettis „fiktionalisierenden Erzählstrategien“ und schildert ohne Bruch auch von dem Zeitpunkt an, da er nicht mehr auf die niedergelegten Erinnerungen seines Gegenstandes bauen kann, die von ihm ausgeforschten Lebenswege Canettis.
So entsteht auch und gerade in der Auseinandersetzung mit den Gegenstimmen und alternativen Perspektiven der Freunde und Bekannten das Lebensbild eines Schriftstellers, das den ebenso scharfsinnigen wie scharfzüngigen Porträts, die der „Menschenfresser“ Canetti anzufertigen wußte, an Präzision und Hellsicht in nichts nachsteht, jedoch gerade auf deren oft allzu große Schonungslosigkeit verzichtet. In den Mittelpunkt rückt Hanuschek entsprechend den Roman Canettis, seine Theaterstücke, natürlich die Autobiographie, das von Canetti selbst als opus magnum angesehene Hauptwerk Masse und Macht (1960) und das kaum zu übersehende „Zentralmassiv“ der Aufzeichnungen, von denen erst ein paar auslesehafte Bände veröffentlicht sind.
Dagegen tritt die Schilderung von Canettis vielen, kaum zu überschauenden Liebesbeziehungen angenehm zurück. Sie ist bei Hanuschek von einer Noblesse und Diskretion geprägt, die manchen Leser enttäuschen mag, den vornehmlich am schriftstellerischen Werk interessierten Beobachter aber wohltuend unbehelligt läßt von einem Enthüllungsgeschrei, das naturgemäß die ernsthafte Lektüre eines Lebenswerks zu überlagern droht. Hier gilt die Aufmerksamkeit des Biografen in erster Linie natürlich dem Verhältnis zwischen Canetti und seiner vergötterten ersten Frau Veza Taubner-Calderon – ihre Ehe dauerte von 1934 bis zu ihrem Tod 1963 –, deren Schriftstellertum Canetti in seiner Autobiographie seltsamerweise gänzlich verschwiegen und deren Entdeckung als Autorin er in seinen letzten Lebensjahren beglückt verfolgt hat.
Dieser ebenso wie Canettis zweiter Ehe (1971-1988) mit Hera Buschor, einer 1933 geborenen Restauratorin, die der Dichter seit Mitte der fünfziger Jahre kannte, aber auch den Affären mit Friedl Benedikt und der Malerin Marie-Louise von Motesiczky folgt Hanuschek im Licht von Canettis weitverzweigten „paarkritischen Aufzeichnungen“. Veza, Friedl und Marie-Louise waren für Canetti, der seine eigene Familie größtenteils verloren hatte, vor allem im Londoner Exil seit Ende der dreißiger Jahre jenseits aller erotischen Verstrickungen eine neue Familie, mit der er in wechselnden Konstellationen – am Ende, nach Heras Krebstod 1988 mit der gemeinsamen Tochter Johanna, zusammenlebte.
Lebendig, gleichwohl gänzlich unprätentiös zeichnet Hanuschek hier die verschiedenen Lebens- und Werklinien auf und verliert sich dabei weder in theoretischen Diskursen noch in wüsten Spekulationen. Der Befürchtung Canettis vor der „Übersetzung“ seiner Person „in Germanistik“ entgeht Hanuschek durch seine Sachlichkeit und Zurückhaltung, ohne dabei den Gegenstand unter dem Glassturz bloßer Verehrung zu konservieren. Im Epilog seiner Biografie läßt er dem Dichter das letzte Wort und zitiert dessen Liebeserklärung an seine zweite Frau Hera und die gemeinsame Tochter, für die er sein früheres Leben aufgeschrieben hat: „Johanna werde ich Geschichten erzählen, wann immer sie es sich wünscht. Hera soll mir jede mißtrauische Regung vergeben, ich wollte, daß alles zwischen uns vollkommen ist, und vollkommen ist es geworden.“

Von Oliver Jahn