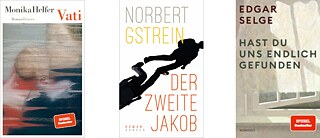Dieser Konflikt wiederum kam allerdings wenig überraschend: Auch im Bücherjahr 2021 gruppierten Debatten und Standpunkte sich erneut zuverlässig um das, was nach wie vor mit dem so abgenutzten wie schwammigen Schlagwort „Identitätspolitik“ beschrieben wird. Wenn zukünftige Gespräche über (deutschsprachige) Literatur diesen Begriff durch präzisere Analysen ersetzten, wäre bereits viel gewonnen. Definiert man Identitätspolitik in der Literatur als einen Versuch, sich der eigenen Herkunft, der eigenen Geschichte, Familie zu versichern und die ihnen zugrunde liegenden Strukturen zu erfassen, sind ein Großteil der im Jahr 2021 von der Kritik vielbeachteten Romane die Resultate identitätspolitischer Überlegungen. Die Frage, die sich auch in diesem Zusammenhang stellt, ist: Hat man es mit einem ästhetisch überzeugenden Werk zu tun?
Mit Monika Helfer, Norbert Gstrein und Edgar Selge haben drei Autorinnen und Autoren im vergangenen Jahr Bücher vorgelegt, die sich auf jeweils ganz und gar unterschiedliche, herausragende Weise mit den Themen Herkunft und Familie auseinandersetzen: Die Österreicherin Monika Helfer hat nach ihrem Erfolgsroman „Die Bagage“ mit „Vati“ ein schmales, aber intensives Buch geschrieben, in dem sie versucht, dem großen Unbekannten ihres Lebens auf die Spur zu kommen – ihrem Vater, der versehrt aus dem Zweiten Weltkrieg nach Hause kam, die Kinder nach dem Tod der Mutter auf die Verwandtschaft verteilte und abtauchte. Norbert Gstrein dagegen, in Hamburg lebender Österreicher, kombiniert in „Der zweite Jakob“ mit unverwechselbarer Eleganz eine unheimliche Serie von Frauenmorden mit der Krise eines Schauspielers kurz vor seinem 60. Geburtstag. Ein Mann, der in der Angst lebt, die Psychopathologie seines Onkels geerbt zu haben und der am Ende wieder im Tiroler Dorf seiner Kindheit landet. Und noch ein Schauspieler: Edgar Selge, Jahrgang 1948, ist mit „Hast du uns endlich gefunden“ ein staunenswertes literarisches Debüt gelungen. Er erzählt vom Aufwachsen als Sohn eines Gefängnisdirektors, von der musischen Atmosphäre in seinem Elternhaus, die ihn aber vor Schlägen durch den Vater und Demütigungen durch die Eltern nicht bewahrte. Ein Bildungsroman, geboren aus dem Geist der belasteten deutschen Wirtschaftswunderjahre.
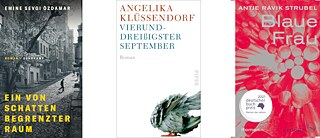
Wie die Kunst nicht nur zum Lebenszweck, sondern buchstäblich auch zu einer Behausung werden kann, zeigt Emine Sevgi Özdamar in ihrem lange erwarteten Roman „Ein von Schatten begrenzter Raum“, ihrem ersten seit 17 Jahren, erschienen zu Özdamars 75. Geburtstag. Es ist der Rückblick auf ein Leben zwischen Istanbul, Paris und Berlin (Ost und West); ein Abgesang auf eine Epoche der Libertinage, die von Ideologien und Gewalt zerbröselt wurde.
Die Ost-West-Perspektive beleuchten auch zwei der meistgelobten Romane des vergangenen Jahres: Angelika Klüssendorf lässt in „Vierunddreißigster September“ die Lebenden und die Toten eines brandenburgischen Dorfes gleichberechtigt auftreten. Aus dieser Idee gewinnt sie komödiantische Momente, zugleich aber ruft sie gerade westdeutschen Leserinnen und Lesern ins Gedächtnis, dass Redewendungen wie die vom „abgehängten Osten“ grob abwertend sind und den individuellen biografischen Erfahrungen nicht annähernd gerecht werden. Den begehrten Deutschen Buchpreis gewann die Schriftstellerin Antje Rávik Strubel mit ihrem Roman „Blaue Frau“, der auf erzählerisch kunstvolle und sprachlich poetische Weise die Erfahrung einer Vergewaltigung mit dem erweiterten Blick auf das komplexe Verhältnis zwischen Ost- und Westeuropa verbindet. In ihrer Dankesrede thematisierte die Schriftstellerin den, wie sie es ausdrückte, Krieg, „der um Bezeichnungen und Benennungen geführt wird, also darüber, wer wir sein dürfen und wer das Sagen darüber hat“.
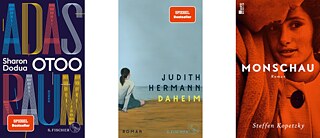
Zwei literarische Erzählungen von dezidiert weiblicher Wehrhaftigkeit haben Judith Hermann und Sharon Dodua Otoo geschrieben. Die in London lebende Otoo inszeniert in „Adas Raum“ gleich mehrere Frauenbiografien in unterschiedlichen Machtverhältnissen quer durch die Jahrhunderte – ein Buch, das die Kritik in seiner gleichberechtigten Reihung unterschiedlicher Erfahrungen von Benachteiligung spaltete. Fast ausschließlich begeistert hingegen wurde „Daheim“, der zweite Roman von Judith Hermann, aufgenommen, der in seiner elegisch schwebenden Stimmung ganz bewusst an Hermanns 1998 erschienenen Erzählungsband „Sommerhaus, später“ anknüpft. Die Protagonistin ist ebenso wie die Figuren aus den Erzählungen älter geworden und hat sich in ein einsames Haus an der Nordsee zurückgezogen, um den Fallen ihrer Existenz zu entkommen.
2021 war das zweite Corona-Jahr. Steffen Kopetzky ist einer der auf hohem Niveau unterhaltsamsten Autoren, die es in Deutschland derzeit gibt. Sein Roman „Monschau“ erzählt nun auch vom Ausbruch einer Epidemie: Im Jahr 1962 grassierten im Eifeldorf Monschau die Pocken. Ein Ingenieur des dort ansässigen Hochofenbetriebs hatte sie aus Indien mitgebracht. Das ist keine Erfindung, doch wie Kopetzky um die Tatsachen herum einen spannenden Plot baut und zugleich den hilflosen, fatal an 2020 erinnernden Umgang mit der hochansteckenden Krankheit freilegt, ist ein Bravourstück. Auch bei Steffen Kopetzky spiegelt sich in den historischen Ereignissen immer die Gegenwart.
Christoph Schröder, Jahrgang 1973, arbeitet als freier Kritiker u.a. für den Deutschlandfunk, die Süddeutsche Zeitung und die Zeit.
Erwähnte Bücher:
Sharon Dodua Otoo: Adas Raum, S. Fischer Verlag.
Norbert Gstrein: Der zweite Jakob, Hanser Verlag.
Monika Helfer: Vati, Hanser Verlag.
Judith Hermann: Daheim, S. Fischer Verlag.
Angelika Klüssendorf: Vierunddreißigster September, Piper Verlag.
Steffen Kopetzky: Monschau, Rowohlt Berlin Verlag.
Emine Sevgi Özdamar: Ein von Schatten begrenzter Raum, Suhrkamp Verlag. Antja Rávik Strubel: Blaue Frau, S. Fischer Verlag.
Edgar Selge: Hast du uns endlich gefunden, Rowohlt Verlag.
Copyright: © Litrix.de