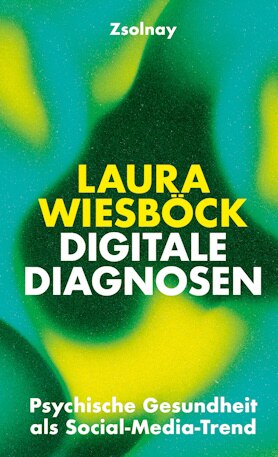Sachbuch
Laura Wiesböck
Digitale Diagnosen. Psychische Gesundheit als Social-Media-Trend
Übersetzungsförderung
Für diesen Titel bieten wir eine Übersetzungsförderung ins Polnische (2025 - 2027) an.
Der digitale Hype um Mental Health
„Digitale Diagnosen“ – ist hier der Besuch beim Tele-Arzt gemeint, die Fernbehandlung bei „TeleClinic“ oder sonst einem Anbieter, der uns Zeit im Wartezimmer erspart? Laura Wiesböck bohrt tiefer. Die österreichische Soziologin will wissen, wie sich im Social-Media-Zeitalter das Digitale und das Diagnostische zueinander verhalten. Sie geht einer Intuition nach, die wir alle haben, wenn wir Wörter wie „toxisch“, „Trauma“ oder „Trigger“ hören (oder selbst verwenden). Das waren psychologische Fachbegriffe, mit denen jetzt, vor allem im Internet, eigene Leidenserfahrungen benannt und gleich auch diagnostiziert werden. Die Therapie folgt auf dem Fuße, verordnet nicht von qualifiziertem Personal, sondern von Netz-Freund*innen oder Influencer*innen. Diese Art von öffentlichem Kranksein ohne Krankenschein und Rezept hat sich in den Social Media zum Mega-Trend entwickelt. Wiesböcks Buch widmet sich der Pathologie dieses neuartigen digitalen Phänomens.
Ein Kennzeichen des „Healthism“ ist die stolze Präsentation der eigenen Krankheit, vor allem die der interessanten Krankheit. Depressionen können romantisch sein, wenn „sad girls“ sie im Netz inszenieren. ADHS erklärt und entschuldigt auffälliges Verhalten von jungen Männern, die sich für besonders intelligent halten. Auch ohne klinischen Befund dürfen die digitalen Kranken auf Zuspruch seitens der Netzgemeinde rechnen. Die soziale Anerkennung ersetzt auf diese Weise die ärztliche Diagnose. Vor allem psychische Krankheiten junger Menschen haben gute Chancen auf dem Marktplatz digitaler Aufmerksamkeit. Während die Expertise tatsächlicher Fachleute in den Hintergrund rückt, ist die „Erfahrungsexpertise“ von Patient*innen und Follower*innen auf dem Vormarsch. Eine ADHS-Influencerin etwa spricht zu ihrer Kundschaft ohne ärztliche Autorität, dafür mit einer doppelten Dosis Empathie.
Wiesböck zeigt am hochkritischen Thema Krankheit/Gesundheit, wie digitale Kommunikation heute insgesamt funktioniert. Sie mag hier und da noch faktenbasiert sein, ihre eigentlichen Treiber aber sind werbliche Bilder und „Narrative“. Die diagnostische Gefühlskultur, die sich derzeit im Netz ausbreitet, zeigt starke Symptome geistiger Unreife (um hier ebenfalls eine Laien-Diagnose zu stellen). Das betrifft den Umgang mit Krankheit und Leid ebenso wie den Kult um die eigene Schönheit, die Kommerzialisierung von „care“ und „healing“. Eine ärztliche Therapie wäre nötig, aber die Erkrankten lassen sich lieber von ihresgleichen therapieren. Wie konnte es soweit kommen? Den Hauptschuldigen macht Wiesböck im „Neoliberalismus“ aus, womit ein Problem ihres ansonsten höchst lehrreichen Buches benannt ist. Neoliberalismus, damit meint die Autorin, wohl im Anschluss an Foucault, eine bestimmte liberal-kapitalistische Herrschaftsform, die uns Selbst-Techniken auferlegt, wie den Zwang zur Selbstoptimierung und zum „unternehmerischen Selbst“. Wir regieren uns selbst und falsch, weil der Neoliberalismus es so will, so etwa muss man Wiesböck verstehen. Wer aber fordert von wem tatsächlich die Unterwerfung unter den digitalen Gesundheitswahn? Sind es nicht vielleicht die Kund*innen selbst, die nicht von den Apparaten lassen können? Und sind es nicht die Tech-Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf dem Begehren dieser Kundschaft beruht, werbliche Bilder von sich selbst zu kommunizieren?
Bei Wiesböck kann man den Eindruck gewinnen, es seien die Staaten und Regierungen selbst, die ihren Bürger*innen ein neoliberales Anforderungspaket mit auf den Weg gäben. Egal, ob nun Leistung, Verantwortung, Wettbewerb oder Unternehmertum, für Wiesböck sind dies gesellschaftliche Imperative, die zwangsläufig die digitalen Nutzer*innen in die Krise treiben. Dass niemand gezwungen ist, auf seinem Smartphone dem „Healthismus“ zu verfallen, beirrt die Autorin nicht. Stattdessen hält sie am Ende ihres Buches ein „Plädoyer für zwischenmenschliche Ambivalenz und Trost“. Das ist gut und richtig, aber es muss auch Wirtschaftszweige geben dürfen, die nicht vom Sorge-Gedanken geleitet sind. Wiesböcks Gesellschaftsanalyse kann in einigen Punkten durchaus hinterfragt werden, aber das nimmt ihrer Kritik an digitalen Fehldiagnosen nichts von ihrer Berechtigung und gesellschaftlichen Bedeutung.
Von Christoph Bartmann
Christoph Bartmann war Leiter der Goethe-Institute in Kopenhagen, New York und Warschau und lebt heute als freier Autor und Kritiker in Hamburg.