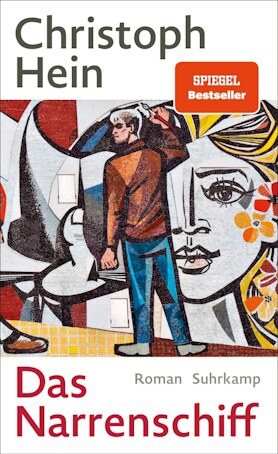Belletristik
Übersetzungsförderung
Für diesen Titel bieten wir eine Übersetzungsförderung ins Polnische (2025 - 2027) an.
Keine Stunde Null
Christoph Hein ist wahrscheinlich der bedeutendste noch lebende DDR-Autor. Geboren 1944 in Oberschlesien, wuchs Hein in der Nähe von Leipzig auf. Seine 1982 veröffentlichte Novelle „Der fremde Freund“ erschien in der Bundesrepublik ein Jahr später unter dem Titel „Drachenblut“. Es war der Beginn einer Schriftstellerkarriere, die sich auch nach dem Fall der Mauer fortsetzte. Denn entgegen bösartigen Prophezeiungen war Hein mit dem Untergang der DDR sein Stoff nicht ausgegangen. Vielmehr wurde er zum Chronisten deutsch-deutscher Verhältnisse. In Romanen wie „Willenbrock“ oder auch „Guldenberg“ beschrieb er das gesellschaftliche Knirschen, die Wiedervereinigungsschmerzen, das Aufeinanderprallen von Haltungen, den Prozess von Desillusionierung, der sich nicht selten in Wut niederschlug.
Hein ist kein Ideologe und kein Scharfmacher. Auch wenn er zumeist von unten, aus der Perspektive so genannter kleiner Leute, auf das Land schaut, ist ihm nichts ferner als billiger Populismus. Nun, im Alter von 81 Jahren, hat Hein seinen mit knapp 800 Seiten nicht nur umfänglichsten Roman geschrieben – „Das Narrenschiff“ lässt sich tatsächlich als Opus Magnum, als Text gewordene Lebensbilanz verstehen. Der Roman, und das ist kein Paradoxon, beweist zweierlei. Erstens: Christoph Hein ist kein begnadeter Stilist und erhebt auch nicht den Anspruch, einer zu sein. Zweitens: Er ist trotzdem oder gerade deshalb ein großer Autor. Gradlinig, mit einem ausgezeichneten Blick für sprechende Details, gestützt auf ein breites Wissen und mit Sinn für atmosphärische Umschwünge, erzählt Christoph Hein die Geschichte der DDR von Anfang bis Ende. Und wer glaubt, er habe das alles schon einmal gelesen und wisse Bescheid, könnte damit richtig liegen und wird an diesem Buch trotzdem seine helle Freude haben.
Der Titel „Das Narrenschiff“ ist eine Anspielung auf Sebastian Brants 1494 erschienene Moralsatire, die Hein nun auf den sozialistischen Staat münzt. Darauf angesprochen, sagte Hein in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“: „Was sollte sie sonst gewesen sein? Die Wirtschaftspolitik der DDR basierte auf der Grundannahme, dass man die Inflation per Befehl abschaffen könnte. Die Preise in der DDR wurden künstlich auf dem Niveau von 1944 konserviert, ob für ein Brötchen oder für die Miete einer Wohnung. Das konnte nicht gut gehen. Das war Narretei, die reine Dummheit.“ Um den Prozess des Scheiterns glaubwürdig darstellen zu können, hat Hein in „Das Narrenschiff“ die Perspektive gewechselt. Seine Hauptfiguren sind keine kleinen Leute, sondern Mitglieder der DDR-Nomenklatura, die auf unterschiedliche Weise in das System eingebunden waren und manchmal von ihm auch wieder ausgestoßen wurden.
In der Eröffnungsszene besucht Wilhelm Pieck, der Gründungspräsident der Republik, eine Grundschule und trifft auf ein Mädchen namens Kathinka. Deren Familiengeschichte verfolgt Heins Roman. Kathinkas Vater ist von den Nationalsozialisten ermordet worden; ihr neuer Stiefvater Johannes Goretzka macht zunächst Parteikarriere – bis zu jenem Punkt, an dem er den Planvorgaben der Partei widerspricht und degradiert wird. Kathinkas Mutter Yvonne wiederum wird aufgrund der Beziehungen ihres Mannes zur Leiterin der Berliner Kulturhäuser ernannt, ohne dass sie überhaupt einen Anflug von Ahnung hat, was sie dort zu tun hat. Aber sie arbeitet sich hinein, und das bedeutet in diesem Fall: Sie lernt, sich adäquat innerhalb des Systems zu bewegen und sich trotzdem Freiräume zu schaffen.
„Das Narrenschiff“ ist ein Buch über hochfliegende Pläne, über Anpassung und Opportunismus, über Karrierismus und Selbstverleugnung. Und es ist auch ein Roman darüber, dass es so etwas wie eine Stunde Null weder in West- noch in Ostdeutschland gegeben hat. Das Muster, nach dem Fachleute den planwirtschaftlichen Strategien der Partei in dem Wissen widersprechen, dass diese unrealistisch oder gar unsinnig sind, zieht sich durch den gesamten Roman. Dasselbe gilt für den Umstand, dass Menschen auf Positionen gesetzt werden, für die sie nicht qualifiziert sind, so beispielsweise auch der hoch renommierte Anglist Benaja Kuckuck, der sowohl in West- als auch in Ostdeutschland durch alle ideologischen Raster gefallen ist und schließlich als Zensor für Kinder- und Jugendfilme eingesetzt wird. Die Ironie des Schriftstellers Christoph Hein besteht darin, dass er derartig groteske Konstellationen unkommentiert darstellt und sie in erstaunlich frischen Dialogen sichtbar macht. Mit diesem Verfahren – lebensnahe Situationserzählungen, kombiniert mit historischen Abrissen – erzielt Christoph Hein ein Höchstmaß an Anschaulichkeit und Glaubwürdigkeit. „Das Narrenschiff“ ist erzählte Geschichte im besten Sinn.
Der Autor selbst hat in seinem Roman im Übrigen auch einen Auftritt: Die Kathinka-Figur ist angelehnt an Christoph Heins im Jahr 2002 verstorbene Ehefrau, die Regisseurin und Dramaturgin Christiane Hein. Es ist ihre Familiengeschichte, die Hein erzählt. Als er, der Student der Mathematik und Philosophie, der im Roman den Namen Rudolf Kaczmarek trägt, Kathinkas Eltern vorgestellt wird, sagt er rundheraus, dass er als Agnostiker nur an das unzweifelhaft Beweisbare glaube: „Ebenso halten wir es mit den Utopien, mit Heilsversprechungen und Zukunftsvisionen. Sie mögen realistisch sein oder nicht, wir halten uns zurück.“ Eine pragmatische Haltung, die Christoph Hein sich bis ins hohe Alter bewahrt hat.
Von Christoph Schröder
Christoph Schröder, geboren 1973, lebt und als freier Autor und Kritiker in Frankfurt/Main. Er schreibt unter anderem für die ZEIT, den Deutschlandfunk und SWR Kultur.