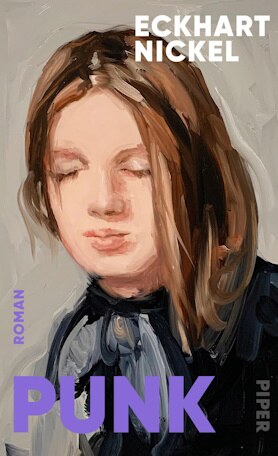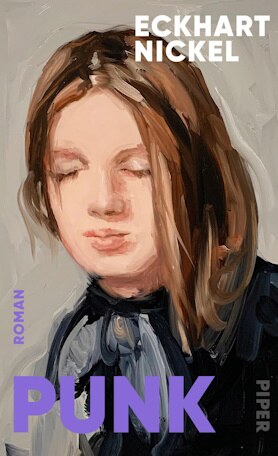Empowerment für die Kunst
Seit Jahrzehnten baut der Frankfurter Autor Eckhart Nickel literarische Schutzräume für die Schönheit. In Zeiten, die herausfordernd sind für unsere liberale Demokratie, zeigt seine herausragende Trilogie – „Hysteria“, „Spitzweg“ und „Punk“ –, dass Schönheit eine Ressource sein kann, für die es sich auch zu kämpfen, mindestens jedoch zu leben lohnt.
„Irre!“ Dieses Wort taucht besonders häufig auf in Eckhart Nickels „Punk“-Roman. „Irre!“, das ist nicht nur eine Anspielung auf das Roman-Debüt von Büchner-Preisträger Rainald Goetz aus dem Jahr 1983, „irre!“ ist jede Seite dieser euphorischen, alle Fenster aufreißenden Pop-Geschichte.
Wie aus dem Nichts taucht in naher Zukunft eine seltsame akustische Erscheinung auf. Es ist keine neue Musikrichtung, sondern eine Art allpräsentes Rauschen, das euphemistisch als „weißer Lärm“ bezeichnet wird. Dieser weiße Lärm wird zum Hintergrundgeräusch. Die Physik kennt das „weiße Rauschen“, das störende Akustik überlagert, nachgerade dimmt, angenehmer gestaltet. Hier verhindert der so ähnlich klingende „weiße Lärm“ jegliche Wahrnehmung von Musik. Er unterdrückt: negative Reden, verletzende Statements, jede Intervention. Es entsteht ein wokes Phantasialand.
“Der vielleicht überraschendste Nebeneffekt des Weißen Lärms bestand darin, dass durch die übertönten negativen Affekte bald auch sämtliche Glücksgefühle wie Begeisterung und Euphorie verschwanden, aber nicht durch Interventionen, sondern ganz beiläufig und en passant. Als hätte jemand einen Regler heruntergedreht und damit der allgemeinen Gefühlsskala des Menschen ihre Extreme entzogen und die Enden gekappt, sodass, im Geräuschjargon gesprochen, nur noch Mitteltöne in einem begrenzten Spektrum überhaupt übrig geblieben waren.“
Erzählerin des Romans ist die junge Um-die-Zwanzigjährige Karen. Nach dem Abitur wird sie in die WG der kunstinteressierten Brüder Ezra und Lambert aufgenommen, die ihren ganz eigenen Umgang mit der seltsamen Akustikerscheinung gefunden haben. Das kuriose Duo lebt in einer konservierten Version jenes popkulturellen Verweisraums, der spätestens mit Einstellung der Spex-Printausgabe geschlossen und seitdem nicht mehr geöffnet wurde; in einer Gestimmtheit, die sich zusammensetzt aus Film-Zitaten, philosophischen Verdrehungen, Insiderwissen abseitiger Indie-Bands, aus einer wissenschaftlichen Betrachtung der Unterhaltungsindustrie. Ezra und Lambert sind erstklassige Nerds, Lordsiegelbewahrer dieser untergegangenen Kultur.
Das Duo hat ein schallisoliertes Stereolabor entworfen, in dem sie – entgegen aller Verbote – Musik produzieren: Punk! Und Karen soll ihre Sängerin werden. Vor welchen regulatorischen Herausforderungen diese Protest-Band steht, soll nicht verraten werden, nur so viel: Das Stereolabor ist ein typischer Ort für die Literatur Eckhart Nickels. Denn eine Festung gegen die Empfindungslosigkeit gab es bereits im vorangegangenen „Spitzweg“-Roman aus dem Jahr 2022, damals nicht als „Stereolab“, sondern etwas profaner als „Kunstversteck“ bezeichnet. Auch Nickels mehrfach ausgezeichnetes „Hysteria“-Debüt (erschienen 2018) erzählte von einem Schutzraum gegen die entfremdete, von unsinnlichen Fakes kontaminierten Simulationswelt.
Das Misstrauen begann bei „Hysteria“ mit dem Biss in eine seltsam fade Himbeere, im folgenden „Spitzweg“-Roman führte die Beschämung durch eine Kunstlehrerin zur Einrichtung besagten „Verstecks“, dem Rückzugsraum der damals vorgestellten Jugendlichen. Auch „Punk“ eröffnet mit einer Beschämung, mit einem peinlichen Klaviervorspiel. Keine Kunst-, sondern die Klavierlehrerin Madame Framboise tritt hier als Advocatus Diaboli auf. Mit dieser französischen Anspielung auf die Himbeere wird sofort klar, dass „Punk“ auch als intra- und extratextuelles Literaturspiel gelesen werden kann. Lustvoll folgt man all diesen popkulturellen und auf frühere Bücher anspielenden Verweisen und der daraus entstehenden mehrfachbedeutsamen Überfülle.
Diese Überfülle dient einer dahinterliegenden, Komplexität aufbauenden Poetologie, die sich
gegen Vereinfachungen, übervorsichtige Sprach- und „Art“-Regeln, gegen algorithmisierte,
für die Social-Media-Ausspielung optimierte Songs, kurzum: gegen den Aderlass unserer
humanistischen Erfolgsgeschichte stellt. Kulturkritik ist das durchaus, aber keine opahafte
Früher-war-alles-Spexiger-Haltung. Nickels Sprache ist überbordend expressiv, die
Anspielungen sind fein kuratiert, Emphase und allerlei ernste wie unernste Scherze gestattet.
Diese Literatur des Reichtums verweigert politisch opportune Statements, Likes heischende Empörungen, das gefahrlose Ressentiment. Diese Literatur ist: Empowerment für die Kunst – und sie zeigt, dass die Erscheinung des Schönen eine Ruhestätte sein kann, ein Schutzraum, und Versteck.
Insbesondere in Zeiten wie diesen brauchen wir das Schöne, es begegnet uns immer seltener – kaum noch werden wir ungebrochener Schönheit ansichtig, nur selten finden wir Trost. Trost finden wir immerhin hier – in der Literatur Eckhart Nickels, die sich dem Schönen verpflichtet fühlt und mit einer euphorischen Stimme in die Welt hinausschaut und staunend ruft: „Irre!“
Von Jan Drees
Jan Drees ist Literaturredakteur im Deutschlandfunk und Moderator der Sendung „Büchermarkt“. Er ist im Kritikerteam der 3sat-Sendung „Kulturzeit“, Mitglied verschiedener Jurys und Autor von Romanen und Sachbüchern wie „Staring at the Sun“ (2000), „Letzte Tage, jetzt“ (2011) „Sandbergs Liebe“ (2019) und „Literatur der Krise: Das Novellen-Werk von Hartmut Lange“ (2022). Jan Drees betreibt den Blog lesenmitlinks.de.