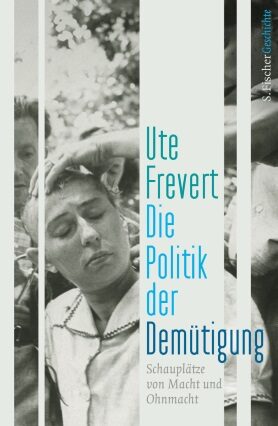Ute Frevert Politik der Demütigung. Schauplätze von Macht und Ohnmacht
- S. Fischer Verlag
- Frankfurt am Main 2017
- ISBN 978-3-103-97222-1
- 326 Seiten
- Verlagskontakt
Die Macht des Prangers
Scham und Schande wird in dem Moment zum politischen Faktor, in dem sie öffentlich sichtbar wird, die Demütigung braucht ein Publikum.
Frevert zeigt, wie die Beschämung seit dem späten Mittelalter als Bestrafung institutionalisiert wurde. Schandpfähle und Pranger waren die Orte, an denen vorzugsweise Diebstähle und Sexualdelikte die öffentlich sichtbare Entehrung der Bestraften zur Folge hatten. Stundenlang an einen Pfahl angebunden waren die Delinquenten den Blicken und dem Spott des Publikums ausgesetzt, von dem sie noch dazu nicht selten mit Gegenständen beworfen wurden. Beim in England üblichen skimmington ride wurden Frauen, die ihre Männer geschlagen hatten, rücklings auf einem Esel sitzend durch die Nachbarschaft geführt – eine Demütigung, die von Topfschlagen und rüder Musik begleitet wurde. Frevert belegt aber auch, wie solche Praktiken im Verlauf des 18. Jahrhunderts allmählich abgeschafft wurden. Im Zuge der von Michel Foucault prominent analysierten Geburt des Gefängnisses (und der Klinik) verlagerten sich schließlich die Techniken der Macht: Wo es zuvor um das Spektakel der Strafe ging, zielten die neuen Sanktionen vermeintlich auf Verbesserung durch Kontrolle und Beobachtung. Was keineswegs das Ende der Demütigung besiegelte – sie war von nun an nur dem Blick der Öffentlichkeit entzogen.
In Ute Freverts umfassendem historischen Überblick geht es um die Ausformungen, in denen der Pranger die Jahrhunderte auf verschiedenste Weise überdauert hat. Die Würde des Menschen ist schließlich auf vielfältige Weise antastbar. In den Schulen, die Frevert als „Laboratorien der Beschämung" charakterisiert und in denen sich Generationen von Pädagogen an der Entwicklung ganzer Demütigungsarsenale versucht haben. Im Verhältnis zwischen den Geschlechtern, wo die Autorin den Grenzverläufen zwischen Vergewaltigung und Sexismus folgt. In den Medien, wo Menschen im Fernsehen herabgewürdigt oder an den sprichwörtlich gewordenen Zeitungspranger gestellt werden. Und auf der Bühne der Politik, wo Ehre und Demütigung
zentrale symbolische Kategorien darstellen. An historischen Fallbeispielen wie Willy Brandts Kniefall in Warschau verdeutlicht Frevert, wie sich eine sogenannte Moralpolitik innerhalb dieser Muster bewegt.
Das Fazit, das die Autorin aus ihrer bis in die Gegenwart der sozialen Medien reichenden Analyse zieht, stimmt nicht optimistisch: Nachdem sich der Staat aus der systematischen Bestrafung durch Demütigung zurückgezogen habe, sei der Pranger auf vielen – oft subtilen – Ebenen zu einem gesellschaftlichen Mechanismus mutiert, der sich auf immer neue Weise Opfer und Anlässe suche. Vor dem auf diese Weise symbolisch gewordenen Pranger, klagt Frevert, „ist heute niemand mehr sicher".

Von Ronald Düker
Ronald Düker ist Kulturwissenschaftler und Autor im Feuilleton der ZEIT. Er lebt in Berlin.
Inhaltsangabe des Verlags
In einem brillanten Gang durch 250 Jahre Geschichte schildert die bekannte Historikerin Ute Frevert, welche Rolle die öffentliche Beschämung in der modernen Gesellschaft spielt. In den unterschiedlichsten Bereichen werden die Demütigung und das damit einhergehende Gefühl der Scham zum Mittel der Macht – ob in der Erziehung von Kindern, im Strafrecht oder in Diplomatie und Politik.
So wurden nach 1944 in Frankreich Frauen, die sich mit deutschen Besatzern eingelassen hatten, die Haare geschoren. Richter in den USA bestrafen Bürger neuerdings damit, dass diese an belebten Straßen auf einem Schild ihr Vergehen kundtun müssen. Nicht zuletzt der Medienpranger – wie im Fall von Jan Böhmermanns Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten Erdogan – und das Internet haben die öffentliche Beschämung allgegenwärtig gemacht.
Ute Frevert zeigt nicht nur an zahlreichen Beispielen aus der Geschichte, wie Demütigungen in Szene gesetzt wurden und werden (wobei sich die Bilder über Epochen und Kulturen hinweg erstaunlich gleichen). Sie macht auch klar, dass die Moderne den Pranger keineswegs abgeschafft, sondern im Gegenteil neu erfunden hat. Nicht mehr der Staat beschämt und demütigt, sondern die Gesellschaft.
(Text: S. Fischer Verlag)