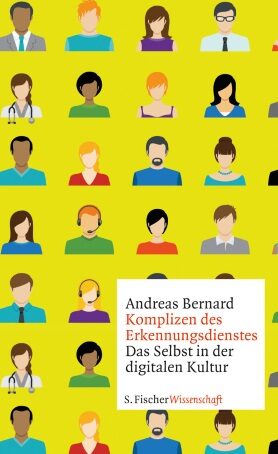Andreas Bernard Komplizen des Erkennungsdienstes. Das Selbst in der digitalen Kultur
- S. Fischer Verlag
- Frankfurt 2017
- ISBN 978-3-10-490444-3
- 240 Seiten
- Verlagskontakt
Andreas Bernard
Komplizen des Erkennungsdienstes. Das Selbst in der digitalen Kultur
Digitale Sammelwut: Eine Kulturtechnik zwischen Autonomie und Kontrolle
Doch der Protest ist immens. Der Zensus, so der Präsident des statistischen Bundesamts, sei in einem Maße zum Gegenstand der öffentlichen Diskussion geworden „wie es von keinem der Beteiligten vorausgesehen worden ist“. Andreas Bernard, Professor am „Center for Digital Cultures“ an der Universität Lüneburg, zitiert diese Einschätzung ebenso wie den Anti-Zensus-Ratgeber „Was Sie gegen Mikrozensus und Volkszählung tun können“, der sich damals 250.000 Mal verkaufte. Das Ziel der Volkszählung, heißt es darin, sei „die totale Überwachung aller und die Steuerung künftigen Verhaltens“. Willkommen in der Welt von Facebook und Amazon! Willkommen im Jahr 2018!
Andreas Bernard erinnert nicht aus Zynismus an die Proteste von 1987. Sondern um zu zeigen, wie bahnbrechend der Bruch mit dem Wissensparadigma der analogen Welt aus heutiger Sicht ist. Jeder Nutzer eines sozialen Netzwerks gibt im Jahr 2018 ein Vielfaches jener Informationen preis, die drei Dekaden zuvor noch als Kontrollinstrument einer totalitären Staatsmacht geächtet wurden. Wie wir heute wissen, stellen die meisten Nutzer von Onlineplattformen ihre Daten dem Datenmissbrauch sehenden Auges zur Verfügung.
1987 wurde die Kritik am Zensus immer wieder mit den „Registrationsexzessen“ der Nazis in Verbindung gebracht. Der Zweite Weltkrieg lag gerade einmal eine Menschengeneration zurück. Heute, so legt Bernard nahe, scheint Gras über die Sache gewachsen zu sein. Die heutige Vernetzungs-, Überwachungs- und Profilierungsbereitschaft zeigt einen mentalen Wandel an, der noch Generationen von Wissenshistorikern beschäftigen wird. Wie kommt es, dass sich die Vision des Internets als eine den Einzelnen in die Unmündigkeit treibende Superkraft, wie sie in dem Hollywood-Thriller „Das Netz“ mit Sandra Bullock noch 1995 imaginiert wird, schon knapp zwanzig Jahre später in eine hyperindividualistische Utopie verwandeln konnte? Wie ist zu erklären, dass trotz unheimlicher Datenskandale à la Cambridge Analytica die Menschen ungebrochen an die produktiven Kräfte des Netzes glauben? So sehr, dass für viele ein Leben ohne die Schaufensterfunktion digitaler Plattformen heute nicht mehr vorstellbar und wünschenswert ist.
Bernard untersucht nun diesen menschheitsgeschichtlich schmalen Raum, in dem die digitalen Medien zur Matrix unseres Alltagslebens werden konnten. Im Anschluss an Michel Foucaults „Archäologie der Humanwissenschaften“ stellt er die neuen Techniken der Datenerfassung in ihrer Geschichtlichkeit dar. In fünf Kapiteln rekonstruiert er ihre Entstehungs- und Verbreitungsgeschichte ausgehend von der Physiognomik eines Lavater über die Anthropometrie des Kriminologen Alphonse Bertillon im neunzehnten Jahrhundert bis hin zu den Tracking-Methoden des Militärs (GPS) und der Polizei (Elektronische Fußfessel) und schließlich der Unterhaltungsbranche (Apple-Watch).
Das Buch beginnt mit dem Wissensformat Profil. „Bis vor 20 oder 25 Jahren waren nur Serienmörder oder Wahnsinnige Gegenstand eines ‚Profils’. Diese Wissensform, dieses Raster der Menschenbeschreibung hat im letzten Vierteljahrhundert eine so rasante wie tiefgreifende Umwandlung erlebt.“ Wer heute auf die Chance verzichtet, ein Profil zu erstellen, riskiert die soziale Isolation. Bernard erinnert daran, dass viele jugendliche Amokläufer sich zuvor durch ihre Internet-Abstinenz verdächtig gemacht hatten.
Verhaltensauffällig ist heute derjenige, der sich der Profilkonvention entzieht. Nicht derjenige, für dessen Anomalie früher ein Täterprofil erstellt werden musste.
Für die heute allgegenwärtige Trackingtechnologie GPS (Global Positioning System) gilt ähnliches wie für das Profil. In den neunziger Jahren noch zu militärischen, dann kriminalistischen Zwecken verwendet, findet das Mittel der technischen Observation bald Einzug in die zivile Nutzung. Spätestens mit der Einführung des ersten iPhones am 29. Juni 2007. Heute lassen sich die geistigen und physischen Wege eines Smartphone-Benutzers erschreckend einfach rekonstruieren und versilbern. Seltsamerweise nimmt die breite Masse der Nutzer wenig Anstoß daran. Zu fortgeschritten ist ihre Abhängigkeit von den Selbstvernetzungs- und Selbstvermessungs-Applikationen der modernen Telekommunikation.
Gemeinsamer Nenner aller Technologien, die Bernard in den Blick nimmt, ist die Genealogie ihrer Anwendung. Immer steht zu Beginn ein militärischer, geheimdienstlicher oder kriminalistischer Anlass, der ihre Entwicklung forciert. Salopp gesagt: Wo früher „Vorsicht, Überwachung“ drauf stand, liest man heute „Achtung, Kreativität“. Die repressiven Technologien von damals sind die emanzipatorischen „Tools“ von heute. Doch stimmt das? Nein, natürlich nicht, daran lässt Andreas Bernard keinen Zweifel. Das Paradox unserer Zeit besteht in einer schwer zu fassenden Gleichzeitigkeit von (Selbst-)Kontrolle und Autonomieversprechen. Wie diese beiden Paradigmen künftig miteinander interagieren werden, können auch Wissenshistoriker schwer voraussehen. Aber Bernard bleibt optimistisch: „Das Versprechen unserer Selbstentfaltung ist eine mächtigere Waffe als jede Vereinheitlichung der Gedanken.“

Von Katharina Teutsch
Katharina Teutsch ist Journalistin und Kritikerin und schreibt unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, den Tagesspiegel, die Zeit, das PhilosophieMagazin und Deutschlandradio Kultur.
Inhaltsangabe des Verlags
In seinem Buch »Komplizen des Erkennungsdienstes« geht es Andreas Bernard um das Selbst in der digitalen Kultur. Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass auffällig viele Verfahren der Selbstpräsentation und Selbsterkenntnis in der digitalen Kultur auf Methoden zurückgehen, die in der Kriminologie, Psychologie und Psychiatrie seit dem Ende des 19. Jahrhunderts erdacht wurden:
Das Format des »Profils«, in den Sozialen Netzwerken heute unbestrittener Ort der Selbstdarstellung, entstand als »psychiatrisches Profil« von Internierten oder als »Täterprofil« von Serienmördern. Die Selbstortung auf dem Smartphone, ohne die kein Pokémon-Go-Spiel und keine Registrierung bei Uber, Yelp oder Lieferando möglich wäre, nutzt eine Technologie, die bis vor zehn Jahren hauptsächlich im Zusammenhang mit der elektronischen Fußfessel bekannt war. Und die Vermessungen der »Quantified Self«-Bewegung zeichnen Körperströme auf, die einst die Entwicklung des Lügendetektors voranbrachten.
Andreas Bernard fördert die wissensgeschichtlichen Zusammenhänge zutage und geht der irritierenden Frage nach, warum Geräte und Verfahren, die bis vor kurzem Verbrecher und Wahnsinnige dingfest machen sollten, heute als Vehikel der Selbstermächtigung gelten.
Text: S. Fischer
(Text: S. Fischer Verlag)