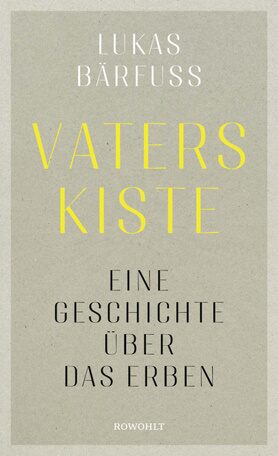Lukas Bärfuss Vaters Kiste. Eine Geschichte über das Erben
- Rowohlt Buchverlag
- Hamburg 2022
- ISBN 978-3-498-00341-8
- 96 Seiten
- Verlagskontakt
Italienische Rechte bereits vergeben.
Was wir den Nachgeborenen schulden
Der Essay „Vaters Kiste“ basiert auf Vorträgen, die Bärfuss an der Universität Zürich und am Deutschen Nationaltheater Weimar gehalten hat. Der Untertitel des schmalen Buchs lautet „Eine Geschichte über das Erben“. Im dezidiert politischen und radikal moralischen Denken des Autors weist der Vorgang des Erbens weit über private Konstellationen hinaus und bezieht sich, menschheitlich gesehen, auf die „Teilhabe der Nachgeborenen, deren Schicksal wir bestimmen mit dem, was wir ihnen hinterlassen“. Mit „wir“ ist der Teil der Spezies gemeint, der den Reichtum und die Macht besitzt, um seine Lebensweise dem restlichen Teil zu verordnen und damit zu definieren, wie künftige Generationen den Planeten und die Zivilisation vorfinden werden.
Seine Überlegungen zu den „Rechten der Nachgeborenen“ veranlassten Bärfuss zu einer Auseinandersetzung mit seinem eigenen Erbe, seiner Herkunft, die eigentlich ein idealer Romanstoff im Sinne des vor allem in Frankreich blühenden Genres der „Autosoziobiografie“ wäre. Sein Weg aus Armut, Bildungsferne und Obdachlosigkeit über verschiedene Handwerksberufe bis zum Büchner-Preisträger und Hochschulprofessor ist beispielhaft für den Aufstieg eines Benachteiligten, der kraft intellektueller Anstrengung die soziale Determination überwindet und dennoch stets markiert bleibt durch sein Ursprungsmilieu.
Doch die kritische Gesellschaftsanalyse, die bei den französischen Vorbildern in epische Lebenserzählungen eingebettet ist, trennt Bärfuss präzise von individuellen Befindlichkeiten. Hier schildert er so knapp wie plastisch seinen familiären Hintergrund, seine desolate Jugend und Adoleszenz und seine Selbstbefreiung durch die Literatur. Und lässt durchblicken, dass er nicht beabsichtigt, ausführlicher davon zu berichten. Stattdessen will er die historischen, politischen und ökonomischen Ursachen erhellen, die bewirken, dass Biografien wie die seine im globalen Kontext vereinzelte Glücksfälle bleiben. Denn mag er auch gegen seine Schweizer Heimat vieles vorzubringen haben, bleibt er sich doch dessen bewusst, welch ein Vorzug es war, in eine der wohlhabendsten Wirtschaftsnationen der Welt hineingeboren zu werden.
„Vaters Kiste“, der Auslöser für den Rückblick, ist eine Pappschachtel, die Bärfuss ausgehändigt wurde, nachdem der „Mann, von dem es hieß, er sei mein Vater gewesen“, als schwarzes Schaf der Familie einsam auf der Straße gestorben war, und die der Sohn 25 Jahre verschlossen hielt wie die Büchse der Pandora. Was sie dann preisgab, waren die spärlichen, aber prägnanten Zeugnisse eines verpfuschten Lebens, Dokumente über Armut, Schulden und Kriminalität. Sie konfrontierten den Autor noch einmal mit dem Elend, in dem er beinahe selbst versunken wäre. Und sie lösten den Gedankengang aus, in dem Bärfuss den aktuellen Zustand seiner, unserer Gesellschaft in Beziehung setzt zu Vergangenheit und Zukunft. Das geschieht sprunghaft und assoziativ, kühn behauptend und scharf sezierend, in Rundumschlägen und Detailbetrachtungen, aber stets auf der Grundlage von Lektüre und Anschauung zu gleichen Teilen.
Es geht dabei um Erbrecht und Privateigentum, um Darwins „Entstehung der Arten“ und die Erfindung des Nationalstaats, um Sozialanthropologie und Metaphysik, Sprache und Demokratie, Technologie und Ungleichheit. Es geht um geistige Vermächtnisse und profanen Müll, um Krieg, Kondensstreifen am Himmel und das Kenotaph in Hebron, um Täuschungen und Lügen und die Frage, „was wir verschweigen und wann“. Und dazwischen geht es immer wieder um den Vater, der es, trotz günstigerer Voraussetzungen, anders als der Sohn nicht schaffte, sich in einem bürgerlichen Leben einzurichten.
Über solche Widersprüche hinweg spannt Bärfuss einen Bogen von der Genesis bis zur Gegenwart, um dann aus seinen Befunden konkrete Handlungsvorschläge abzuleiten, die der Verantwortung für das Erbe künftiger Generationen Rechnung tragen. Das mag abenteuerlich anmuten – und ist es auch. Am Ende steht die Erkenntnis, dass Lukas Bärfuss hier einen dramaturgischen Leitfaden für das Denken in Zusammenhängen vorlegt. Und es gibt kaum etwas, das in diesen desorientierten und existenziell bedrohlichen Zeiten dringender gebraucht würde.

Von Kristina Maidt-Zinke
Kristina Maidt-Zinke ist Literatur- und Musikkritikerin der Süddeutschen Zeitung und rezensiert für Die Zeit.
Inhaltsangabe des Verlags
Das Erbe seines Vaters hat Lukas Bärfuss ausgeschlagen: Es waren vor allem Schulden. Geblieben ist nur eine Kiste, die der Sohn nach fünfundzwanzig Jahren zum ersten Mal in Augenschein nimmt und die ihn zurückführt in seine eigene, schwierige Kindheit, in eine Jugend auf der Straße. Die Fragen werden drängend: Was hat er geerbt von seinem abwesenden, kriminellen Vater? Wie steht es um ein auf Privatvermögen zielendes Erbrecht, das uns, obwohl kaum hundert Jahre alt, wie ein Naturgesetz vorkommt? Wie steht es um die Verantwortlichkeit jenseits der familiären Bindung, wie steht es um die Teilhabe der Nachgeborenen, deren Schicksal wir bestimmen mit dem, was wir ihnen hinterlassen, mit unserem Erbe, unserem Müll? Antworten werden sich nicht finden lassen, solange das planende Denken vor dem Wegfall aller Selbstverständlichkeiten die Augen verschließt, solange es sich einer Enttäuschung verweigert, die uns die wichtigen Fragen erst ermöglichen würde: Wollen wir weiter so leben wie bisher?
Und wenn nicht: wie dann?
(Text: Rowohlt Buchverlag)