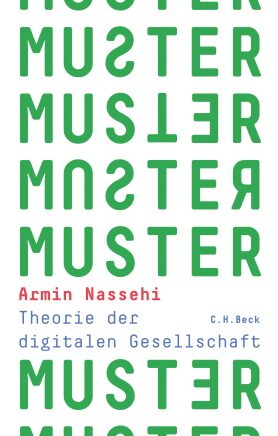Armin Nassehi Muster. Theorie der digitalen Gesellschaft
- C.H.Beck Verlag
- München 2019
- ISBN 978-3-406-74024-4
- 352 Seiten
- Verlagskontakt
Keine Panik, wir waren schon immer digital
Was hätte Foucault nun zu den epistemischen Umwälzungen des digitalen Zeitalters gesagt, dem wir uns heute oft hilflos ausgeliefert fühlen? Repräsentation diente ja zunächst dazu, Unsichtbares sichtbar zu machen, zum Beispiel durch die Anatomie in der Medizin oder durch die Grammatik in der Sprachwissenschaft. In der Analyse Nassehis führen die Zeichen aber – inzwischen auf ihre Schrumpfform von Nullen und Einsen gebracht – ein ziemlich fruchtbares Eigenleben. Entkoppelt von der echten Welt, die sie doch zu repräsentieren angetreten sind, werden sie jetzt selbst schöpferisch. Ganze Welten entstehen, die gar nicht mehr den Anspruch haben, sich auf eine Referenzwelt zu beziehen. „Die Daten sind selbst das Material, mit dem etwas erzeugt wird: Erkenntnisse, und darüber hinaus: Produkte, Dienstleistungen, politische Kontrolle, Strafverfolgung, Spionage, technische Steuerung etc.“
Die Digitalisierung dient also wie die gute alte Statistik zunächst dem Sammeln und Kombinieren von Daten. Die daraus gewonnenen Informationen wiederum schaffen dann neue Realitäten. Der unromantische und maximal überindividuelle Markt der Online-Dating-Plattformen, in dem durch Datenabgleich Wahrscheinlichkeiten für individuelles Glücksversprechen errechnet werden, steht dafür. Sammeln, Informieren und Synthetisieren: Daraus ergeben sich Realitätseffekte in der analogen Sphäre, an denen sich derzeit viele Kulturwissenschaftler die Zähne ausbeißen. Sind wir am Ende gar nicht so autonom und eigensinnig, wie es uns die emanzipatorische Erzählung vom Subjekt weismachen will?
Der Clou an Nassehis Ausführungen: Die Digitalisierung ist bei allem, was sie uns heute an Schauervisionen über unsere Unmündigkeit mitliefert, nicht überraschend über uns gekommen. Es ist nicht eine Technik, die dem Individuum aufgepfropft wurde und dieses nun unaufhaltsam in die Knie zwingt. Es verhält sich geradezu umgekehrt. Provokativ anti-alarmistisch entwickelt Nassehi die Idee, dass die Suche nach Mustern genuin zur Erfahrung der Moderne gehört. „Nicht der Computer hat die Datenverarbeitung hervorgebracht, sondern die Zentralisierung von Herrschaft in den Nationalstaaten, die Stadtplanung und der Betrieb von Städten, der Bedarf für die schnelle Bereitstellung von Waren für eine abstrakte Anzahl von Betrieben, Verbrauchern und Städten/Regionen.“ Die Digitalisierung sei deshalb die Antwort auf eine Frage, die die moderne Gesellschaft selbst seit jeher aufwirft – die nach Form, Struktur und Steuerbarkeit.
Anders verhielt es sich mit vormodernen Gesellschaften: „In früheren Gesellschaften waren etwa die gesellschaftliche Position und der soziale Status einer anderen Person immer schon transparent. Es gab sogar mehr oder weniger ausgefeilte Zeichen, vor allem Rang- und Funktionszeichen, etwa durch Kleidung codiert, so dass die soziale Struktur relativ einfach analog sichtbar werden konnte. Analog meint: in konkreter praller Empirie mit Alltagmitteln beobachtbar. Relevantes Wissen über die Gesellschaft erhielt man anhand der bloßen Kenntnis dessen, was man sehen konnte, kombiniert mit den Bewertungsformen über die entsprechenden kulturellen Zeichen.“
Nassehi führt die digitale Mustererkennung bereits auf unser allgemeines Kommunikationsverhalten zurück: Komplexe Gesellschaften, die komplexe Botschaften verhandeln, sind auf Mustererkennung angewiesen: „Denn unser Bewusstsein muss schon in etwa kennen, was es sehen kann, sonst kann es die Dinge nicht identifizieren.“ Frei nach Husserl: „Wir testen mit der Wahrnehmung letztlich Hypothesen über die Welt.“
Das Originelle an Nassehis Buch ist sein Zugriff auf das derzeitige Angstthema aller Medientheoretiker. Während die meisten Analysen des Digitalen vor den epistemologischen Effekten warnen, versucht der Münchner Soziologe diese zu historisieren und damit zu entdramatisieren. Das personenbezogene Datensammeln der Statistik (Geschäftsgrundlage der Soziologie) ist in dieser Erzählung die kleine Schwester der grassierenden Informatisierung.
Für welches Problem, um es nun mit Nassehi selbst zu sagen, ist die Digitalisierung die Lösung? Für das Problem komplexer Gesellschaften schlechthin: Kontrolle zu gewinnen über aus dem Ruder laufende Einzelinteressen, Einzelaussagen, Einzelphänomene in den Bereichen Kriminalität, Konsum und Weltanschauung. Die Digitalisierung bietet hier: modernes Datenmanagement in unübersichtlichen Zeiten. Denn nur so lassen sich die verborgenen Antriebe komplexer Gesellschaften verstehen und ihre Entwicklungen voraussehen. Oder manipulieren.
Wie jeder Prozess, so kann auch jener der Digitalisierung nicht abschließend begriffen werden. Nassehis Studie ist aber eine anregende Sicht auf unser datenwütiges Jahrhundert und eine gute Ergänzung zum landläufigen Digitalisierungsskeptizismus, der das kritische Denken mitunter mehr lähmt als beflügelt.

Von Katharina Teutsch
Katharina Teutsch ist Journalistin und Kritikerin und schreibt unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, den Tagesspiegel, die Zeit, das PhilosophieMagazin und Deutschlandradio Kultur.
Inhaltsangabe des Verlags
Wir glauben, der Siegeszug der digitalen Technik habe innerhalb weniger Jahre alles revolutioniert: unsere Beziehungen, unsere Arbeit und sogar die Funktionsweise demokratischer Wahlen. In seiner neuen Gesellschaftstheorie dreht der Soziologe Armin Nassehi den Spieß um und zeigt jenseits von Panik und Verharmlosung, dass die Digitalisierung nur eine besonders ausgefeilte technische Lösung für ein Problem ist, das sich in modernen Gesellschaften seit jeher stellt: Wie geht die Gesellschaft, wie gehen Unternehmen, Staaten, Verwaltungen, Strafverfolgungsbehörden, aber auch wir selbst mit unsichtbaren Mustern um?
Schon seit dem 19. Jahrhundert werden in funktional ausdifferenzierten Gesellschaften statistische Mustererkennungstechnologien angewandt, um menschliche Verhaltensweisen zu erkennen, zu regulieren und zu kontrollieren. Oft genug wird die Digitalisierung unserer Lebenswelt heutzutage als Störung erlebt, als Herausforderung und als Infragestellung von gewohnten Routinen. Im vorliegenden Buch unternimmt Armin Nassehi den Versuch, die Digitaltechnik in der Struktur der modernen Gesellschaft selbst zu fundieren. Er entwickelt die These, dass bestimmte gesellschaftliche Regelmäßigkeiten, Strukturen und Muster das Material bilden, aus dem die Digitalisierung erst ihr ökonomisches, politisches und wissenschaftliches Kontroll- und Steuerungspotential schöpft. Infolge der Digitalisierung wird die Gesellschaft heute also regelrecht neu entdeckt.
(Text: C.H.Beck Verlag)