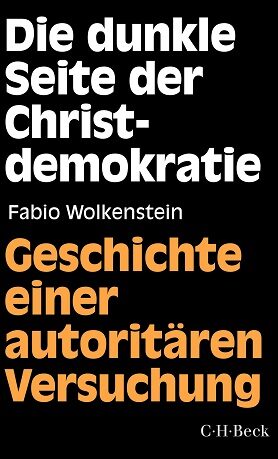Fabio Wolkenstein Die dunkle Seite der Christdemokratie. Geschichte einer autoritären Versuchung
- C.H.Beck Verlag
- München 2022
- ISBN 978-3-406-78238-1
- 222 Seiten
- Verlagskontakt
Gegen Liberalismus und Sozialismus: Eine Geschichte der Christdemokratie
Wolkenstein zeichnet in seiner Studie die Geschichte des politischen Katholizismus in Europa von der Französischen Revolution bis in die Gegenwart nach. Seinen Schwerpunkt legt er dabei auf die Phase der Entstehung katholischer und im engeren Sinn christdemokratischer Bewegungen und Parteien seit dem späten 19. Jahrhundert.
Er zeigt, dass eine breite Strömung katholischer Parteipolitik bis zum Zweiten Weltkrieg nicht in der Demokratie, sondern in der Monarchie, im Ständestaat oder gar in der Diktatur die bessere Staatsform erblickte und sich mit dieser demokratieskeptischen bis -feindlichen Positionierung die antimoderne Haltung der römisch-katholischen Kirche zu eigen machte. Zugleich aber hält er fest: „Aus historischer Sicht haben konservative Parteien oft eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung der Demokratie gespielt.“ Wir haben es also mit einer politischen Strömung zu tun, die widersprüchliche programmatische und ideologische Tendenzen in sich vereint, unter anderem auch, um als Volksparteien unterschiedliche Milieus repräsentieren zu können.
Schon am Verhältnis des politischen Katholizismus zur Kirche wird dies deutlich: Wolkenstein zeichnet nach, wie sich Ideen und Formulierungen aus verschiedenen
päpstlichen Enzyklika in den programmatischen Äußerungen vieler katholischer Intellektueller und Politiker wiederfinden. Zugleich achteten viele europäische Parteien, die sich als katholische Parteien begriffen, penibel darauf, politisch unabhängig von Papst und Kurie zu bleiben.
Die westeuropäische Christdemokratie, wie wir sie seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Gestalt dezidiert demokratischer Parteien kennen, kann nicht für sich beanspruchen, die „wahre Christdemokratie“ zu sein. Der ungarische Ministerpräsident und Vorsitzende der ursprünglich liberalen Partei Fidesz, Viktor Orbán, der sich inzwischen zum Bewahrer christdemokratischer Werte stilisiert, könne sich wiederum zurecht darauf berufen, dass die westeuropäischen Christdemokraten „schon lange keine traditionell christdemokratische Politik betreiben würden“, meint Wolkenstein.
Der politische Katholizismus war seit Ende des 19. Jahrhunderts stark von der christlichen Soziallehre beeinflusst, die ihrerseits eine Antwort darstellte auf die rasante Entwicklung kapitalistischer Gesellschaften und die politische Selbstorganisation der Arbeiterinnen und Arbeiter in sozialistischen Parteien. Christlich, genauer: katholisch inspirierte Politik war seither eine Politik, die sich gegen Liberalismus und Sozialismus gleichermaßen wandte. Noch heute könnte man etwa in der Politik der deutschen Unionsparteien – die als quasi-ökumenisches Projekt einen christdemokratischen Sonderfall darstellen – ein fernes Echo der Antwort sehen, die Papst Leo XIII. in der Enzyklika „Rerum Novarum“ auf die scharfen Klassengegensätze seiner Zeit gab: „Die Antwort des Papstes auf die soziale Frage ist nicht etwa die Abschaffung der Ungleichheit, sondern ihre harmonische Verwaltung“, schreibt Wolkenstein.
Um gesellschaftliche Harmonie herzustellen, bedarf es aber nicht zwingend demokratischer Verhältnisse. Überraschend sei weniger, dass es im politischen Katholizismus viele undemokratische Tendenzen, sondern eher, „dass es auch demokratische Bewegungen gab“, analysiert Wolkenstein. Erst die Erfahrung der Totalitarismen von Stalinismus und Nationalsozialismus lässt die Demokratie für die Päpste und viele Katholiken in einem besseren Licht erscheinen. Dennoch ist eine christlich-soziale Politik der Harmonisierung gesellschaftlicher Verhältnisse keineswegs auf den konstitutionellen Rahmen der Demokratie angewiesen, wie Wolkenstein anhand der Geschichte verschiedener Parteien zeigt: „Auch lange nach dem Zweiten Weltkrieg existierten in Europa noch dezidiert autoritäre katholische Regime, die sich der gesellschaftlichen Integration, dem Klassenkompromiss, der Akkommodation von Interessensgegensätzen und damit implizit auch dem Pluralismus verschrieben haben.“ Als Beispiel nennt Wolkenstein den „Estado Novo“ des asketischen, gläubigen portugiesischen Technokraten Salazar, zu dem viele Politiker christdemokratischer Parteien, darunter auch der deutschen Union, beste Beziehungen pflegten. Viele Protagonisten des politischen Katholizismus befanden auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs, dass auch ein autoritärer Ständestaat einem harmonischen Interessensausgleich zuträglich sein kann.
Die aktuelle Wiederbelebung des christlichen Autoritarismus in Ungarn und Polen erscheint Wolkenstein daher nur als „ein besonders sichtbares Beispiel für das zyklisch wiederkehrende Erstarken traditionalistischer und bisweilen auch demokratiefeindlicher Kräfte innerhalb politischer Parteien, die sich der Verteidigung christlicher Werte verschrieben haben“. Am Ende seines ideengeschichtlich aufschlussreichen, stringent argumentierenden und gut lesbaren Buchs zeigt Wolkenstein, dass viele Christdemokraten etwa die Politik Viktor Orbáns noch heute für unterstützenswert und mit einer christdemokratischen Programmatik kompatibel erachten. Mit Empfehlungen ans christdemokratische Lager hält sich der Autor weitgehend zurück, kommt aber doch zum Schluss, dass die Christdemokraten gut daran täten, weniger nach „Ideen aus früheren Jahrhunderten zu kramen“, und stattdessen einer Parole Franz Josef Strauß‘ zu folgen und „an der Spitze des Fortschritts zu marschieren“.

Von Ulrich Gutmair
Ulrich Gutmair ist Kulturredakteur der taz. Vor kurzem ist die englische Übersetzung seines Buchs über die Nachwendezeit in Berlin bei Polity Books erschienen: "The First Days of Berlin. The Sound of Change."
Inhaltsangabe des Verlags
In Ungarn wickelt Viktor Orbáns Fidesz-Partei gerade die Demokratie ab und beruft sich dabei besonders emphatisch auf die christdemokratische Tradition. Ein ungehöriger Affront, könnte man meinen. Aber wie ernst war es christdemokratischen Parteien in der Vergangenheit eigentlich mit der liberalen Demokratie?
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs feierte die Christdemokratie in Europa ihren Siegeszug. Dabei setzten sich besonnene Staatsmänner wie Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi oder Robert Schuman auf einem vormals von Krieg und Gewalt geprägten Kontinent nachdrücklich für Frieden, Wiederaufbau und Stabilität ein. Dennoch hatte die Christdemokratie im Nachkriegseuropa auch eine dunkle Seite: Der autoritäre Geist des reaktionären politischen Katholizismus wirkte in ihr weiter, was sich etwa an der unverhohlenen Bewunderung vieler Christdemokraten für Diktatoren wie Franco und Salazar oder einem angespannten Verhältnis zur freien Presse und den Institutionen der liberalen Demokratie offenbarte. Durch die schrittweise Abkehr von konservativen Positionen – in Deutschland vor allem in der Ära Kohl vollzogen – erfuhr die Christdemokratie schließlich einen nachhaltigen Demokratisierungsschub. Allerdings war der Preis dafür eine ideologische Entkernung. Fabio Wolkenstein blickt in seinem Buch auf die lange und wechselvolle Geschichte der Christdemokratie in Europa zurück und fragt, welchen autoritären Versuchungen sie widerstanden, aber auch welchen sie nachgegeben hat. Dabei spannt er einen weiten Bogen bis zur Gegenwart: Welche Strategien des Machterhalts wählen christdemokratische Parteien heute?
(Text: C.H.Beck Verlag)