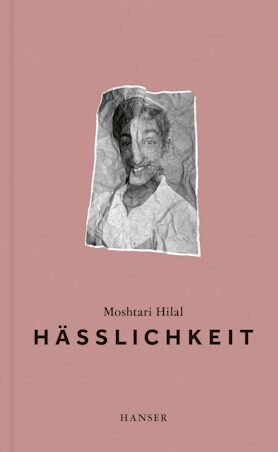Moshtari Hilal Hässlichkeit
- Carl Hanser Verlag
- München 2023
- ISBN 978-3-446-27682-6
- 224 Seiten
- Verlagskontakt
Mit Förderung von Litrix.de auf Italienisch erschienen
Hässlichkeit als Revolte
Das gilt für rassistische Zuschreibungen von „zu“ dunkler Hautfarbe, „zu“ starker Körperbehaarung oder – unter Rassentheoretikern des zwanzigsten Jahrhunderts besonders beliebt – „zu“ großer Nase. Biometrische Pseudowissenschaften machten mit Cesare Lombroso aber schon im neunzehnten Jahrhundert Karriere. Der italienische Arzt meinte, anhand von messbaren Körpermerkmalen, Verbrecher definieren und erkennen zu können. Moshtari Hilal erinnert in ihrem Buch an die lange und unheilvolle Geschichte der modernen Physiognomik, die im Verbund mit der etwa zeitgleich aufkommenden Eugenik Jahrzehnte später zu einer beispiellosen Politik der Vernichtung „unwerten Lebens“ geführt hatte, das immer auch ein Leben in zugeschriebener Hässlichkeit war.
Doch das Gesicht bleibt auch im demokratischen 21. Jahrhundert „hermeneutische Oberfläche“, auf der viel herumgelesen wird. Die globale Schönheitsindustrie macht gute Geschäfte mit ihm. Mittlerweile wird mit technischen Filtern und millionenfach geteilten Gesichtsposen ein neues Idealgesicht verbreitet, in dem verschiedene ethnische Merkmale unterschiedlich fetischisiert werden. Unsere heutige Vermessung von Gesichtsgeometrien per Social-Media-Filter, so zeigt Hilal, erinnert durchaus an die biometrischen Exzesse berühmter Rassentheoretiker.
Die Autorin erinnert in fünf assoziativ aufgebauten Kapiteln daran, dass die Bestimmung des Hässlichen immer mit dem Hass auf die Abweichung beginnt. Dabei nimmt sie aus autobiografischen Gründen die Rhinoplastik in den Blick, die operative Veränderung der Nase, die ausgerechnet von einem jüdischen Arzt etabliert wurde, um der sogenannten „jüdischen Nase“ Abhilfe zu verschaffen. Im Nationalsozialismus verlor Jacques Joseph, der sogenannte „Nasenjoseph“ unter den plastischen Chirurgen, seine Approbation.
Als eine von vier Schwestern, die alle mit einer als zu groß empfundenen Nase zur Welt kamen, hat Hilal bewusst die Angleichung ihrer Nase an westlich geprägte Schönheitsideale verweigert. Über ihre Entscheidung schreibt sie: „Als meine älteste Schwester ihre Nase operieren ließ, kam es mir vor, als hätte man meine Familie kastriert.“ Die Definition von Schönheit, so Hilals Erkenntnis, geht in der Regel mit der Fantasie einher, die Abweichung im idealen Gesicht, in der idealen Behaarungssituation und in der idealen Hautfarbe, abzuwerten und damit die Norm einer Elite zu festigen.
Der antikoloniale Theoretiker Franz Fanon schrieb über die in der kolonialen Gesellschaft etablierten weißen Schönheitsideale, dass sie zur Entfremdung des kolonialen Subjekts von sich selbst führe. „Der Unterdrücker schafft es durch den umfassenden und furchteinflößenden Charakter seiner Autorität, dem Indigenen neue Sichtweisen aufzuzwingen und insbesondere ein abwertendes Urteil über seine ursprünglichen Existenzformen.“ Hilal erinnert ihre LeserInnen an die systematische Darstellung des kolonisierten Körpers als wahlweise kriminell, barbarisch oder schwächlich und sie ergänzt diesen Befund: „Das Weiß strukturiert Begehren, Empfinden, Körper und Geist der Menschen. Das Empfinden der eigenen Haut als falsch, wird zu einer unerträglichen Gefangenschaft in einer Uniform, die niemals abgelegt werden kann.“
Der französische Soziologe Pierre Bourdieu wiederum erinnerte in den späten siebziger Jahren daran, dass die Produktion von Geschmack immer auch Bestandteil eines symbolischen Klassenkampfes ist. So erklärt sich die große Popularität der Rhinoplastik im Iran nicht nur durch rassistisch motivierte Körperbilder, sondern auch durch das klassistische Abgrenzungsbedürfnis einer wachsenden iranischen Mittelschicht, die ihr „gutes Gesicht“ als Zeichen von ökonomischem Erfolg und urbaner Modernität gelesen haben möchte. Das heißt: rassistische und klassistische Machtverhältnisse finden ihren unmittelbaren Ausdruck darin, was gemeinhin als schön oder hässlich empfunden wird.
Moshtari Hilal durchwebt ihr Buch mit kunstvoll verfremdeten Selbstporträts und lyrischen Selbsterkundungen, die von großen Frauennasen und schwarzen Körperhaaren handeln. Ihr spielerischer und vielseitiger Umgang mit dem Attribut der Hässlichkeit lädt die Leserin dazu ein, auch die eigenen Schönheitsideale zu überprüfen, ihren Wandel im Laufe eines Lebens und die in ihnen verborgenen Machtverhältnisse emanzipatorisch zu entziffern. Am Ende wird klar, dass es vor allem die Zuschreibung von Hässlichkeit ist, nicht die Hässlichkeit selbst, deren Antrieb der Hass auf das Andere ist.

Von Katharina Teutsch
Katharina Teutsch ist Journalistin und Kritikerin und schreibt unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, den Tagesspiegel, die Zeit, das PhilosophieMagazin und Deutschlandradio Kultur.
Inhaltsangabe des Verlags
Vom Sehen und Gesehenwerden, von Selbstbildern und Selbstzweifeln – Moshtari Hilal schreibt über Hässlichkeit
Dichte Körperbehaarung, braune Zähne, große Nasen: Moshtari Hilal befragt Ideen von Hässlichkeit. In ihrem einzigartigen Buch schreibt sie von Beauty Salons in Kabul als Teil der US-Invasion, von Darwins Evolutionstheorie, von Kim Kardashian und von einem utopischen Ort im Schatten der Nase. Ihre Erkundungen, Analysen und Erinnerungen, ihre Bildzitate und eigenen Zeichnungen führen in jenen innersten Bereich, in dem jedes Selbstverständnis auf dem Prüfstand steht. Warum fürchten wir uns vor dem Hässlichen? Poetisch und berührend, intim und hochpolitisch erzählt Moshtari Hilal von uns allen, wenn sie von den Normen erzählt, mit denen wir uns traktieren.
(Text: Carl Hanser Verlag)