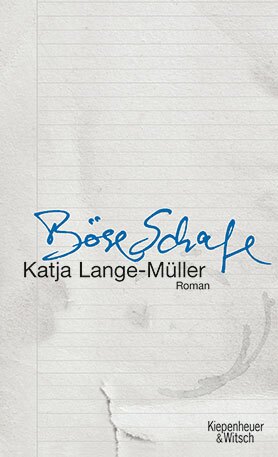Katja Lange-Müller Böse Schafe
- Kiepenheuer & Witsch Verlag
- Köln 2007
- ISBN 978-3-462-03914-6
- 205 Seiten
- Verlagskontakt
Katja Lange-Müller
Böse Schafe
Dieses Buch wurde vorgestellt im Rahmen des Schwerpunkts Portugiesisch: Brasilien (2007 - 2008).
Leseproben
Buchbesprechung
Westberliner Unterschichtsmilieu unmittelbar vor und nach der Wende 1989; ein aidskranker Junkie, der auf Bewährung aus dem Knast draußen ist; eine arbeitslose Frau um die vierzig, die aus Ostberlin in den anderen Teil der Stadt geflüchtet ist und sich mit Gelegenheitsarbeiten als Blumenverkäuferin über Wasser hält: Ist das der Stoff, aus dem sich eine anrührende Liebesgeschichte machen läßt? Katja Lange-Müllers Roman Böse Schafe, der am unteren Ende der Gesellschaft spielt und vom Leben am finanziellen und emotionalen Abgrund erzählt, beweist uns, dass das geht – und zwar ganz ausgezeichnet, so daß die Autorin es mit diesem sozialrealistischen und zugleich ergreifenden Roman im Herbst 2007 völlig zu Recht auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat.
Zu Beginn des neuen Jahrtausends, also fast 20 Jahre nach der Ereignissen, erzählt Soja in der Rückschau von ihren knapp vier – mehr oder weniger gemeinsamen – Jahren mit Harry, dem drogenabhängigen Ex-Knacki, den sie zufällig auf der Straße kennengelernt hat. Vom ersten Moment an ist er, mit einer beängstigenden und beeindruckenden Bedingungslosigkeit, zu ihrem Lebensinhalt geworden. Wild entschlossen, Harry bei seinen Resozialisierungsmaßnahmen zu helfen, stellt sie eine Gruppe von privaten Betreuern zusammen und unterstützt ihn finanziell. All das in der Hoffnung, so verhindern zu können, daß er rückfällig wird, sowohl was die Drogen als auch was die Beschaffungskriminalität angeht.
Soja erscheint also einerseits als selbstlose Helferin, die das Leben des Außenseiters zu organisieren und ihm eine neue Stabilität zu geben versucht. Andererseits aber stabilisiert diese Beziehung auch sie selbst. Denn er ist der erste (und, wie wir später erfahren, auch der einzige) Mann, mit dem sie die Liebe nicht als „Krankheit“ erfährt, die sie „auf den Tod fürchtete“, sondern als „Freiheit verheißende Bedürfnislosigkeit“ und „betörend undramatisches Glück“. Endlich hat sie das Gefühl, gebraucht zu werden und einen Sinn in ihrem Leben zu erkennen, und ist damit von Harry auf ihre Weise ebenso abhängig wie dieser von seinem Stoff. Es ist die Geschichte zweier Süchtiger, die hier schonungslos offen und doch mit großer Zartheit erzählt wird, im steten Suchen nach den richtigen Worten für die schwer begreiflichen Geschehnisse. Und dazu gehört in Lange-Müllers Roman auch der große historische Umbruch, der durch den Fall der Mauer markiert ist.
Nicht nur das eher deprimierende Sozialhilfe-Milieu, in dem diese Liebes- und Passionsgeschichte angesiedelt ist, ist ungewöhnlich für die deutsche Gegenwartsliteratur, sondern ebenso die Weise, wie von diesem amour fou erzählt wird: in der zweiten Person nämlich, als direkte Anrede Sojas an den trotz all ihrer fürsorglichen Bemühungen rückfällig gewordenen und 1990 schließlich in einem Hospiz an Aids gestorbenen Geliebten. Dieses innere Zwiegespräch mit dem in vieler Hinsicht Treulosen – wie ihre einstigen Gespräche auch ein eher einseitiger Austausch – ist noch immer getrieben von Wut und Fassungslosigkeit über den Verrat, den er an ihr und ihrer bis zur Selbstaufopferung gehenden Liebe begangen hat. Und zugleich ist es doch eine einzige große Liebeserklärung über den Tod hinaus. Seit sie sich zum ersten Mal begegnet sind, hat Harry ihr „Leben nicht mehr verlassen“.
Ausgelöst wird Sojas retrospektive Auseinandersetzung mit dem abwesenden Geliebten durch dessen sporadische und von Kälte und Zynismus geprägte Notizen, die Soja Jahrzehnte nach Harrys Tod zum ersten Mal liest. Weil es ihr schwerfällt zu begreifen, daß sie selbst darin kein einziges Mal erwähnt wird, und ausgehend von einigen in ihrem großen Abschiedsmonolog zitierten Passagen, versucht Soja sich in einer einzigen langen Suchbewegung heranzuschreiben an das, was da eigentlich gewesen oder eben gerade nicht gewesen ist zwischen ihnen – an das, was doch so offensichtlich hätte sein müssen, was sie aber nicht hat sehen können oder wollen. „Ich wollte nicht sehen, was ich, wie sich bald zeigte, nicht sehen konnte, im Sinne von: nicht mit ansehen“. Indem Soja ihre Projektionen und ihr Wunschdenken offenlegt, kreist sie immer drängender um die unbegreifliche Frage: „Warum bin ich abwesend, als wären wir einander nie begegnet?“
Rechenschaft darüber abzulegen, was sie an diesen so unzuverlässigen wie kindlich liebenswerten Menschen derart gebunden hat und noch immer bindet, daß er bis heute ihr Denken und Fühlen bestimmt: das ist das entscheidende Movens hinter Sojas Selbstaussprache. Und erstaunlicherweise hat dieser Monolog, der nach und nach zu einer Art Requiem auf den verlorenen Geliebten wird, für sie tatsächlich eine klärende, ja befreiende Wirkung: „Ich war dabei, mich aufzugeben, bis ich dein Heft las und entdeckte, daß ich ja mit dir reden, dir sogar schreiben kann.“ Diese durchweg persönliche Anrede, der imaginäre Dialog, verleiht dem Roman eine enorme Intensität und Eindringlichkeit und berührt den Leser stärker, als jede andere Erzählform es vermocht hätte.
Seine beeindruckende literarische Qualität zeigt sich auch darin, daß Sojas nachgeholtes Zur-Rede-Stellen des Freundes und ihre Selbstbefragung nie in Kitsch oder Betroffenheitsprosa abgleiten. Das liegt vor allem am unsentimentalen Blick der Erzählerin auf sich selbst. Ihre eigenen Schwächen und Sehnsüchte beschreibt sie so drastisch und schnodderig-direkt, wie sie die Erfahrung der Liebe in einfühlsamen Bildern und mit existentiellem Ernst und noch immer spürbarer Leidenschaft als das für sie Entscheidende benennt, das ihr nicht mehr genommen werden kann.
So ist Sojas Zwiesprache mit dem abwesenden Harry am Ende nicht weniger als ein Hohelied auf die Liebe und die Macht der Erinnerung: „Dieser [ein wenig verblichene und zerkratzte] Film läuft, sobald ich an dich, an uns denke.“ In diesen unzerstörbaren Bildern lebt Harry tatsächlich in ihr fort. Und so kann der Roman seinen versöhnlichen und trotz aller geschilderten Tristesse und Schmerzlichkeit geradezu hoffnungsfrohen Schluß finden: „Wir haben einander und Zeit; nichts sonst, doch davon ganz viel, obwohl es scheint, als existiere sie gar nicht mehr.“

Zu Beginn des neuen Jahrtausends, also fast 20 Jahre nach der Ereignissen, erzählt Soja in der Rückschau von ihren knapp vier – mehr oder weniger gemeinsamen – Jahren mit Harry, dem drogenabhängigen Ex-Knacki, den sie zufällig auf der Straße kennengelernt hat. Vom ersten Moment an ist er, mit einer beängstigenden und beeindruckenden Bedingungslosigkeit, zu ihrem Lebensinhalt geworden. Wild entschlossen, Harry bei seinen Resozialisierungsmaßnahmen zu helfen, stellt sie eine Gruppe von privaten Betreuern zusammen und unterstützt ihn finanziell. All das in der Hoffnung, so verhindern zu können, daß er rückfällig wird, sowohl was die Drogen als auch was die Beschaffungskriminalität angeht.
Soja erscheint also einerseits als selbstlose Helferin, die das Leben des Außenseiters zu organisieren und ihm eine neue Stabilität zu geben versucht. Andererseits aber stabilisiert diese Beziehung auch sie selbst. Denn er ist der erste (und, wie wir später erfahren, auch der einzige) Mann, mit dem sie die Liebe nicht als „Krankheit“ erfährt, die sie „auf den Tod fürchtete“, sondern als „Freiheit verheißende Bedürfnislosigkeit“ und „betörend undramatisches Glück“. Endlich hat sie das Gefühl, gebraucht zu werden und einen Sinn in ihrem Leben zu erkennen, und ist damit von Harry auf ihre Weise ebenso abhängig wie dieser von seinem Stoff. Es ist die Geschichte zweier Süchtiger, die hier schonungslos offen und doch mit großer Zartheit erzählt wird, im steten Suchen nach den richtigen Worten für die schwer begreiflichen Geschehnisse. Und dazu gehört in Lange-Müllers Roman auch der große historische Umbruch, der durch den Fall der Mauer markiert ist.
Nicht nur das eher deprimierende Sozialhilfe-Milieu, in dem diese Liebes- und Passionsgeschichte angesiedelt ist, ist ungewöhnlich für die deutsche Gegenwartsliteratur, sondern ebenso die Weise, wie von diesem amour fou erzählt wird: in der zweiten Person nämlich, als direkte Anrede Sojas an den trotz all ihrer fürsorglichen Bemühungen rückfällig gewordenen und 1990 schließlich in einem Hospiz an Aids gestorbenen Geliebten. Dieses innere Zwiegespräch mit dem in vieler Hinsicht Treulosen – wie ihre einstigen Gespräche auch ein eher einseitiger Austausch – ist noch immer getrieben von Wut und Fassungslosigkeit über den Verrat, den er an ihr und ihrer bis zur Selbstaufopferung gehenden Liebe begangen hat. Und zugleich ist es doch eine einzige große Liebeserklärung über den Tod hinaus. Seit sie sich zum ersten Mal begegnet sind, hat Harry ihr „Leben nicht mehr verlassen“.
Ausgelöst wird Sojas retrospektive Auseinandersetzung mit dem abwesenden Geliebten durch dessen sporadische und von Kälte und Zynismus geprägte Notizen, die Soja Jahrzehnte nach Harrys Tod zum ersten Mal liest. Weil es ihr schwerfällt zu begreifen, daß sie selbst darin kein einziges Mal erwähnt wird, und ausgehend von einigen in ihrem großen Abschiedsmonolog zitierten Passagen, versucht Soja sich in einer einzigen langen Suchbewegung heranzuschreiben an das, was da eigentlich gewesen oder eben gerade nicht gewesen ist zwischen ihnen – an das, was doch so offensichtlich hätte sein müssen, was sie aber nicht hat sehen können oder wollen. „Ich wollte nicht sehen, was ich, wie sich bald zeigte, nicht sehen konnte, im Sinne von: nicht mit ansehen“. Indem Soja ihre Projektionen und ihr Wunschdenken offenlegt, kreist sie immer drängender um die unbegreifliche Frage: „Warum bin ich abwesend, als wären wir einander nie begegnet?“
Rechenschaft darüber abzulegen, was sie an diesen so unzuverlässigen wie kindlich liebenswerten Menschen derart gebunden hat und noch immer bindet, daß er bis heute ihr Denken und Fühlen bestimmt: das ist das entscheidende Movens hinter Sojas Selbstaussprache. Und erstaunlicherweise hat dieser Monolog, der nach und nach zu einer Art Requiem auf den verlorenen Geliebten wird, für sie tatsächlich eine klärende, ja befreiende Wirkung: „Ich war dabei, mich aufzugeben, bis ich dein Heft las und entdeckte, daß ich ja mit dir reden, dir sogar schreiben kann.“ Diese durchweg persönliche Anrede, der imaginäre Dialog, verleiht dem Roman eine enorme Intensität und Eindringlichkeit und berührt den Leser stärker, als jede andere Erzählform es vermocht hätte.
Seine beeindruckende literarische Qualität zeigt sich auch darin, daß Sojas nachgeholtes Zur-Rede-Stellen des Freundes und ihre Selbstbefragung nie in Kitsch oder Betroffenheitsprosa abgleiten. Das liegt vor allem am unsentimentalen Blick der Erzählerin auf sich selbst. Ihre eigenen Schwächen und Sehnsüchte beschreibt sie so drastisch und schnodderig-direkt, wie sie die Erfahrung der Liebe in einfühlsamen Bildern und mit existentiellem Ernst und noch immer spürbarer Leidenschaft als das für sie Entscheidende benennt, das ihr nicht mehr genommen werden kann.
So ist Sojas Zwiesprache mit dem abwesenden Harry am Ende nicht weniger als ein Hohelied auf die Liebe und die Macht der Erinnerung: „Dieser [ein wenig verblichene und zerkratzte] Film läuft, sobald ich an dich, an uns denke.“ In diesen unzerstörbaren Bildern lebt Harry tatsächlich in ihr fort. Und so kann der Roman seinen versöhnlichen und trotz aller geschilderten Tristesse und Schmerzlichkeit geradezu hoffnungsfrohen Schluß finden: „Wir haben einander und Zeit; nichts sonst, doch davon ganz viel, obwohl es scheint, als existiere sie gar nicht mehr.“

Von Anne-Bitt Gerecke