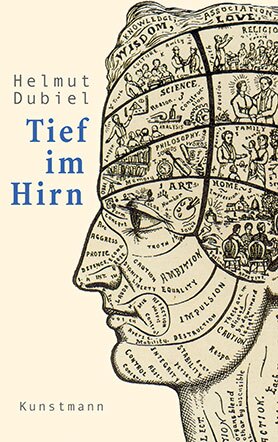Helmut Dubiel Tief im Hirn
- Antje Kunstmann
- München 2006
- ISBN 3-88897-451-8
- 142 Seiten
- Verlagskontakt
Helmut Dubiel
Tief im Hirn
Leseproben
Buchbesprechung
Es kommt nicht oft vor, dass sich in einem Buch persönlicher Erlebnisbericht, sozialwissenschaftliche Überlegungen, Vermittlung von Sachwissen und Weltklugheit auf so prägnante Weise verbinden wie in Helmut Dubiels Buch Tief im Hirn. Dubiel erkrankte im Alter von 46 Jahren an der Parkinsonschen Krankheit, eine Erkrankung, die normalerweise erst in wesentlich höherem Alter auftritt.
Dubiel, Jahrgang 1946, studierte in Bielefeld und Bochum Germanistik und Philosophie und lehrt seit 1992 als Professor für Soziologie an der Justus Liebig Universität in Gießen. Seine Dissertation über "Wissenschaftsorganisation und politische Erfahrung" erschien 1978 und befasste sich mit der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Dubiels intellektuelle Sozialisation ist geprägt von der theoriebeladenen Atmosphäre der späten sechziger und siebziger Jahre in der Bundesrepublik Deutschland.
Deshalb ist es eigentlich nicht unerwartet, wenn Dubiel selbst in einem so persönlichen Text wie der Darstellung der eigenen schweren Krankheit eine Position der kritischen Distanz einnimmt. Selbstmitleid wird man hier vergeblich suchen. Nüchtern beschreibt Dubiel den Verlauf der Krankheit, hebt einzelne Aspekte auf eine abstraktere Ebene, um dann von seinen individuellen Erfahrungen mit Freunden und Kollegen, mit der Krankheit und mit Ärzten auf allgemeinere Entwicklungen oder Phänomene in der Gesellschaft zu schließen.
Neben dem normalerweise mit der Krankheit assoziierten Zittern gehören ebenso Lähmungserscheinungen, Schwindelanfälle und Versteifungen zu den typischen Symptomen, ausgelöst durch die mangelhafte Versorgung des Gehirns mit Dopamin. Die Parkinsonsche Krankheit verursacht das Absterben der so genannten "substantia nigra", die im Gehirn für die Herstellung des körpereigenen Dopamins zuständig ist. Bislang ist die Krankheit nicht heilbar, jedoch gibt es verschiedene - mehr oder minder wirksame - Therapien zur Linderung der Symptome.
Dubiel beschreibt in seinem Bericht, wie er während der ersten Zeit nach der Diagnose der Krankheit seinen Zustand verheimlicht. Aus Scham und Angst, dem gewohnten Bild des erfolgreichen und selbstbewussten Wissenschaftlers auf dem Höhepunkt seiner Karriere nicht mehr entsprechen zu können, beginnt er, einen Großteil seiner Kraft in das Überspielen und Vertuschen seiner Symptome zu stecken. Doch bald wird ihm klar, dass er die ihm zugedachte Rolle als Leiter des berühmten Instituts für Sozialforschung weder übernehmen kann noch will. Was ihm früher wichtig war scheint ihm nun, angesichts seiner veränderten Situation, ganz nebensächlich und der von Konkurrenz geprägte Umgang am Institut stößt ihn ab. Dubiel nimmt eine Gastdozentur in Berkeley an und verbringt danach noch drei weitere Jahre an der New York University.
Dort erlebt er, dass der Umgang mit kranken oder behinderten Mitmenschen in Kalifornien und New York viel gelassener ist als in Deutschland. Er kann seine Krankheit offen benennen, ohne Diskriminierung befürchten zu müssen, aber auch, ohne bemitleidet zu werden.
Obwohl die Zeit in New York eine - den Umständen entsprechend - gute war, verstärkten sich doch die Symptome und Dubiel entschied sich nach seiner Rückkehr auf Anraten verschiedener Ärzte zu einer Operation zum Zweck der Tiefenhirnstimulation. Hierzu werden dem Patienten durch Löcher in der Schädeldecke Sonden ins Tiefenhirn eingeführt und über Drähte mit einem Hirnschrittmacher verbunden, der unter dem Schlüsselbein implantiert wird. Über die Sonden werden bestimmte Hirnregionen stimuliert, die insbesondere die ständigen Überbewegungen regulieren sollen, aber auch das Zittern, die Haltungs- und Gehstörungen sowie die ständigen Wechsel in der Befindlichkeit eindämmen.
Zunächst war die OP ein voller Erfolg, die motorischen Fähigkeiten verbesserten sich schlagartig, und Dubiel schildert seine spontane Reaktion als "euphorisch". Doch schon kurze Zeit darauf stellten sich schwere Depressionen und Sprechstörungen ein. Dubiel konnte nur noch sehr leise sprechen, Worte fielen ihm nicht mehr ein, er stotterte und nuschelte. Gleichzeitig erlebte er viele Ärzte, deren Interesse für seinen Fall nach der "erfolgreichen" Operation rapide abnahm und die ihm rieten, sich mit den Folgesymptomen abzufinden. Doch eine Neurologin schlug vor, den Stimulator doch "einfach einmal abzuschalten" und zu sehen, wie sein Körper reagieren würde. Dubiel tat es und auf Knopfdruck fühlte er sich klar, konnte denken und formulieren und die Depression war wie weggewischt. Gleichzeitig stellten sich jedoch wieder Atemnot und Bewegungsstörungen ein - kurz: er konnte nun wählen zwischen Denken und Gehen.
Sich selbst auf diese Weise als ferngesteuert zu erleben und eine Depression "abschalten" zu können empfand Dubiel als geradezu frivol. Natürlich ist es für die Umgebung befremdend, wenn jemand auf Knopfdruck ein ganz anderer wird. Dass es möglich ist, die seelische Befindlichkeit in einem solchen Maße durch technische Eingriffe zu steuern, erschüttert das Verständnis vom Menschen als Einheit von Körper und Geist grundsätzlich. Zwangsläufig fragt sich jemand, der sich vornehmlich über seine geistige Tätigkeit definiert, nach der Authentizität seiner Persönlichkeit und der Glaubwürdigkeit von Gefühlen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob intellektuelle Fähigkeiten möglicherweise zukünftig technisch zu erzeugen und damit käuflich zu erwerben sein werden und was die Folgen dessen wären.
Dass sich diese grundsätzlichen Gedanken mit ganz persönlichen Schlussfolgerungen verbinden, ist eines der herausragenden Merkmale dieses Buches. Gegen Ende berichtet Dubiel, dass er mit seinem Hirnschrittmacher eine Art Frieden geschlossen hat und ihn so nutzt, wie es eben geht. Begleitet von den Menschen, die ihm am nächsten stehen, hat er gelernt mit der Krankheit zu leben. Und er hat noch etwas gelernt: Dass man nie alle möglichen Folgen seiner Entscheidungen voraussehen kann und dass man, um glücklich sein zu können, wissen muss, dass es noch viel Unbekanntes zu entdecken gibt.

Dubiel, Jahrgang 1946, studierte in Bielefeld und Bochum Germanistik und Philosophie und lehrt seit 1992 als Professor für Soziologie an der Justus Liebig Universität in Gießen. Seine Dissertation über "Wissenschaftsorganisation und politische Erfahrung" erschien 1978 und befasste sich mit der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Dubiels intellektuelle Sozialisation ist geprägt von der theoriebeladenen Atmosphäre der späten sechziger und siebziger Jahre in der Bundesrepublik Deutschland.
Deshalb ist es eigentlich nicht unerwartet, wenn Dubiel selbst in einem so persönlichen Text wie der Darstellung der eigenen schweren Krankheit eine Position der kritischen Distanz einnimmt. Selbstmitleid wird man hier vergeblich suchen. Nüchtern beschreibt Dubiel den Verlauf der Krankheit, hebt einzelne Aspekte auf eine abstraktere Ebene, um dann von seinen individuellen Erfahrungen mit Freunden und Kollegen, mit der Krankheit und mit Ärzten auf allgemeinere Entwicklungen oder Phänomene in der Gesellschaft zu schließen.
Neben dem normalerweise mit der Krankheit assoziierten Zittern gehören ebenso Lähmungserscheinungen, Schwindelanfälle und Versteifungen zu den typischen Symptomen, ausgelöst durch die mangelhafte Versorgung des Gehirns mit Dopamin. Die Parkinsonsche Krankheit verursacht das Absterben der so genannten "substantia nigra", die im Gehirn für die Herstellung des körpereigenen Dopamins zuständig ist. Bislang ist die Krankheit nicht heilbar, jedoch gibt es verschiedene - mehr oder minder wirksame - Therapien zur Linderung der Symptome.
Dubiel beschreibt in seinem Bericht, wie er während der ersten Zeit nach der Diagnose der Krankheit seinen Zustand verheimlicht. Aus Scham und Angst, dem gewohnten Bild des erfolgreichen und selbstbewussten Wissenschaftlers auf dem Höhepunkt seiner Karriere nicht mehr entsprechen zu können, beginnt er, einen Großteil seiner Kraft in das Überspielen und Vertuschen seiner Symptome zu stecken. Doch bald wird ihm klar, dass er die ihm zugedachte Rolle als Leiter des berühmten Instituts für Sozialforschung weder übernehmen kann noch will. Was ihm früher wichtig war scheint ihm nun, angesichts seiner veränderten Situation, ganz nebensächlich und der von Konkurrenz geprägte Umgang am Institut stößt ihn ab. Dubiel nimmt eine Gastdozentur in Berkeley an und verbringt danach noch drei weitere Jahre an der New York University.
Dort erlebt er, dass der Umgang mit kranken oder behinderten Mitmenschen in Kalifornien und New York viel gelassener ist als in Deutschland. Er kann seine Krankheit offen benennen, ohne Diskriminierung befürchten zu müssen, aber auch, ohne bemitleidet zu werden.
Obwohl die Zeit in New York eine - den Umständen entsprechend - gute war, verstärkten sich doch die Symptome und Dubiel entschied sich nach seiner Rückkehr auf Anraten verschiedener Ärzte zu einer Operation zum Zweck der Tiefenhirnstimulation. Hierzu werden dem Patienten durch Löcher in der Schädeldecke Sonden ins Tiefenhirn eingeführt und über Drähte mit einem Hirnschrittmacher verbunden, der unter dem Schlüsselbein implantiert wird. Über die Sonden werden bestimmte Hirnregionen stimuliert, die insbesondere die ständigen Überbewegungen regulieren sollen, aber auch das Zittern, die Haltungs- und Gehstörungen sowie die ständigen Wechsel in der Befindlichkeit eindämmen.
Zunächst war die OP ein voller Erfolg, die motorischen Fähigkeiten verbesserten sich schlagartig, und Dubiel schildert seine spontane Reaktion als "euphorisch". Doch schon kurze Zeit darauf stellten sich schwere Depressionen und Sprechstörungen ein. Dubiel konnte nur noch sehr leise sprechen, Worte fielen ihm nicht mehr ein, er stotterte und nuschelte. Gleichzeitig erlebte er viele Ärzte, deren Interesse für seinen Fall nach der "erfolgreichen" Operation rapide abnahm und die ihm rieten, sich mit den Folgesymptomen abzufinden. Doch eine Neurologin schlug vor, den Stimulator doch "einfach einmal abzuschalten" und zu sehen, wie sein Körper reagieren würde. Dubiel tat es und auf Knopfdruck fühlte er sich klar, konnte denken und formulieren und die Depression war wie weggewischt. Gleichzeitig stellten sich jedoch wieder Atemnot und Bewegungsstörungen ein - kurz: er konnte nun wählen zwischen Denken und Gehen.
Sich selbst auf diese Weise als ferngesteuert zu erleben und eine Depression "abschalten" zu können empfand Dubiel als geradezu frivol. Natürlich ist es für die Umgebung befremdend, wenn jemand auf Knopfdruck ein ganz anderer wird. Dass es möglich ist, die seelische Befindlichkeit in einem solchen Maße durch technische Eingriffe zu steuern, erschüttert das Verständnis vom Menschen als Einheit von Körper und Geist grundsätzlich. Zwangsläufig fragt sich jemand, der sich vornehmlich über seine geistige Tätigkeit definiert, nach der Authentizität seiner Persönlichkeit und der Glaubwürdigkeit von Gefühlen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob intellektuelle Fähigkeiten möglicherweise zukünftig technisch zu erzeugen und damit käuflich zu erwerben sein werden und was die Folgen dessen wären.
Dass sich diese grundsätzlichen Gedanken mit ganz persönlichen Schlussfolgerungen verbinden, ist eines der herausragenden Merkmale dieses Buches. Gegen Ende berichtet Dubiel, dass er mit seinem Hirnschrittmacher eine Art Frieden geschlossen hat und ihn so nutzt, wie es eben geht. Begleitet von den Menschen, die ihm am nächsten stehen, hat er gelernt mit der Krankheit zu leben. Und er hat noch etwas gelernt: Dass man nie alle möglichen Folgen seiner Entscheidungen voraussehen kann und dass man, um glücklich sein zu können, wissen muss, dass es noch viel Unbekanntes zu entdecken gibt.

Von Heike Friesel