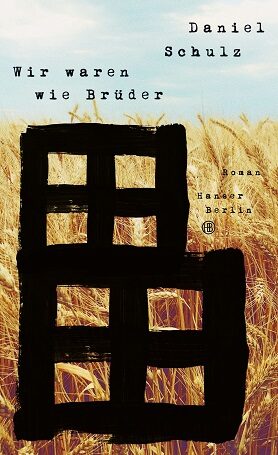Daniel Schulz Wir waren wie Brüder
- Hanser Berlin
- Berlin 2022
- ISBN 978-3-446-27107-4
- 288 Seiten
- Verlagskontakt
Mit Förderung von Litrix.de auf Italienisch erschienen
Klima der Härte
Die Sorge, dass es sich bei dem Roman um eine nur noch einmal in die Breite ausgewalzte Reportage handeln könnte, verfliegt nach den ersten Zeilen, denn es wird sofort deutlich, dass man es hier mit einem Autor zu tun hat, der eine literarische Perspektive, eine literarische Sprache gefunden hat – und mit einem Schriftsteller, der ein gutes Gespür für Dramaturgie hat. „Ich habe meinen ersten Nazi erwischt.“ Das ist der erste Satz des Romans. Der Erzähler, mittlerweile um die 20, sitzt in einer Berliner S-Bahn, und bei einem der Mitfahrer, anhand des Outfits klar als Neonazi identifizierbar, springt das an, was der Ich-Erzähler den „Hippie-Sensor“ nennt: Lange Haare, Brille, Flauschjacke. Ein potentielles Opfer. Der Abend endet dann allerdings damit, dass der glatzköpfige Neonazi blutend am Boden liegt und der Ich-Erzähler zur Polizei verfrachtet wird. Ende der Exposition, Schnitt zurück ins Jahr 1989, in dem ein Staat kollabierte und vieles andere seinen Anfang nahm. Der zehnjährige Protagonist lebt mit seinen Eltern in einer fiktiven brandenburgischen Kleinstadt und hat ein gutes Auge für die Veränderungen, für das Davor und das Danach.
Man könnte meinen, man habe aus dieser Zeit bereits genug Reportagen, genug Augenzeugenberichte gelesen, um zu verstehen, wie sich Strukturen von rechtsradikaler Gewalt im Osten so ungehindert aufbauen konnten. Doch Schulz‘ Milieustudie, die sich über einen Zeitraum von elf Jahren erstreckt, ist nicht nur ein spannendes Buch, sondern auch eines mit hohem Erkenntniswert: Die Neonazis, die Schlägertrupps – sie sind nicht wie UFOs in der ostdeutschen Provinz gelandet, sondern geradezu naturgemäß und organisch aus einem Gemisch von Hoffnungslosigkeit und Opportunismus herausgewachsen. Es ist ein großer und umfassender gesellschaftlicher Transformationsprozess, den Daniel Schulz in einem Mikrokosmos abbildet. Ein Kosmos, in dem die Songs von Matthias Reim und die der Böhsen Onkelz gleichberechtigt nebeneinander stehen. Und das darf man als ein starkes Bild dafür sehen, dass Gut und Böse nicht glasklar getrennt sind.
Das gesellschaftliche Klima verwandelt sich innerhalb kurzer Zeit rasant, als immer offensichtlicher wird, dass die Heilsversprechen von den blühenden Landschaften im besten Fall nur ein grandioser Irrtum waren. Einstmals berufstätige Menschen versinken in depressiven Zuständen oder lassen sich umschulen, was in einem ehemaligen Arbeiterstaat einem Identitätsverlust gleichkommt. Währenddessen nimmt die Härte zu und auch die Fremdenfeindlichkeit und die Gewaltbereitschaft. Diskotheken, Badeseen, Flüchtlingsheime: Es gibt keine Schutzzonen mehr. Auch der Ich-Erzähler muss sich entscheiden, mit wem er sich abgibt, worüber er schweigt und worüber er spricht. Und auch, wie er zu seiner Mitschülerin Mariam steht, deren Familie aus Georgien kommt und die den neuen (ost-)deutschen Verhältnissen mit Furchtlosigkeit begegnet.
Den Druck, die psychische Gewalt, die von jener Postwende-Ära ausgegangen sei, so hat Daniel Schulz es in einem Interview gesagt, empfinde er im Nachhinein als anstrengender und belastender als die Schläge, die er seinerzeit eingesteckt habe. „Wir waren wie Brüder“ ist kein historischer Roman, sondern verweist in mehrfacher Hinsicht auf Kontinuitäten. Der Titel des Romans ist ein Zitat aus einem Song der westdeutschen, rechtsradikalen Band „Böhse Onkelz“, die sich später wenig glaubwürdig von ihrer Vergangenheit distanziert hat. Und einmal dröhnt in Schulz‘ Roman eine Kassette mit dem „Onkelz“-Lied „Danke für nichts“ aus dem Autoradio, in dem sich die Zeilen finden: „Du weißt nicht wo ich herkomm / Selbst wenn du es weißt / Du weißt nicht was ich fühle / Du weißt nicht was es heißt / Ich zu sein.“ Das ist rechtsextreme Identitätspolitik der 1990er-Jahre. Und es klingt ganz und gar aktuell.

Von Christoph Schröder
Christoph Schröder, Jahrgang 1973, arbeitet als freier Autor und Kritiker unter anderem für den Deutschlandfunk, Die Zeit und die Süddeutsche Zeitung.
Inhaltsangabe des Verlags
Er ist zehn, als in der DDR die Revolution ausbricht. Während sich viele nach Freiheit sehnen, hat er Angst: vor den Imperialisten und Faschisten, vor denen seine Lehrerinnen ihn gewarnt haben. Vor dem, was kommt und was er nicht kennt. Wenige Jahre später wird er wegen seiner langen Haare von Neonazis verfolgt. Gleichzeitig trifft er sich mit Rechten, weil er sich bei ihnen sicher fühlt. So sicher wie bei Mariam, deren Familie aus Georgien kommt und die vor gar nichts Angst hat. Doch er muss sich entscheiden, auf welcher Seite er steht. "Wir waren wie Brüder" ist eine drastische Heraufbeschwörung der unmittelbaren Nachwendezeit – und ein nur allzu gegenwärtiger Roman über die oft banalen Ursprünge von Rassismus und rechter Gewalt.
(Text: Hanser Berlin)