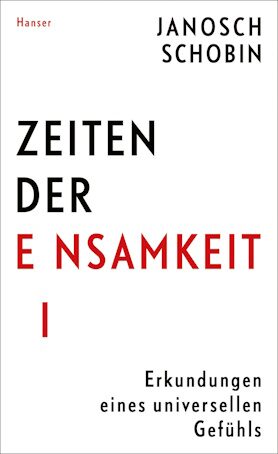Janosch Schobin Zeiten der Einsamkeit. Erkundungen eines universellen Gefühls
- Hanser Berlin
- Berlin 2025
- ISBN 978-3-446-28267-4
- 224 Seiten
- Verlagskontakt
Für diesen Titel bieten wir eine Übersetzungsförderung ins Polnische (2025 - 2027) an.
Das Alleinsein in der Welt
In Janosch Schobins „Zeiten der Einsamkeit. Erkundungen eines universellen Gefühls“ ist Egon keine reale, sondern eine aus vielen von deutschen Ordnungsämtern registrierten Fällen zusammengesetzte Figur. Und der Prototyp eines urbanen Szenarios, das Norbert Elias schon im Jahr 1982 skizziert hatte. In seiner Schrift „Die Einsamkeit des Sterbenden in unseren Tagen“ analysierte der Soziologe, wie mit der Marginalisierung der Religionen allmählich auch die alten Übergangsrituale ad acta gelegt werden und wie der weit verbreitete Ekel vor dem Tod zunehmend dazu führt, dass Sterbende allein gelassen werden. Was aber ist diese Einsamkeit, die offenbar zum Signum der spätmodernen Gesellschaften geworden ist?
Schobin, der, wie Elias, Soziologe ist und an der Universität Kassel unterrichtet, nähert sich dieser Frage anhand sieben weiterer Fallstudien von Menschen, die er in Deutschland aber auch in Chile und den USA persönlich aufgestöbert und in langen Gesprächen begleitet hat. Darunter Pete, den Schobin um sechs Uhr morgens („wenn die Stadt noch schläft, gehört sie den Schlaflosen“) auf einer Parkbank in New York kennenlernte, oder Marta, die eine kleine Fleischerei in Santiago de Chile führt; Gisela, die, irgendwo in Niedersachsen, eines Nachts aufwachte und merkte, dass der neben ihr liegende Sohn nicht mehr atmet. Dies ist eine vielleicht nicht repräsentative Gruppe von Menschen, die ihr Alleinsein in der Welt eint; es ist aber ein Glück, dass Janosch Schobin eine Sprache zur Verfügung steht, die diese Schicksale auch ohne den auf Statistik gegründeten Jargon seiner Fachwissenschaft zu vermitteln vermag. Schobin ist Erzähler genug, um ein empathisches und facettenreiches Bild dieses tristen Gegenstands zu zeichnen.
Als historisch bemerkenswert verdeutlicht der Soziologe, dass das Herausfallen aus der Gesellschaft gar nicht immer als schlecht oder doch zumindest als ambivalent empfunden wurde. Schobins auch geistesgeschichtlich bewanderte Chronik der Einsamkeit führt von Francis Bacon über Montaigne und Shakespeare zu Oscar Wilde und dann ins zwanzigste Jahrhundert, von Samuel Beckett zu Heinrich Böll. Dabei zeigt der Autor, wie das Leiden unter der Verlassenheit vielleicht auch nur die kleine Schwester der Lust am Alleinsein ist, das ja lange sogar als etwas Heiliges und als Ideal-Setting für wahrhaft geniale künstlerische oder philosophische Schöpfungsakte betrachtet wurde. Man darf jedoch davon ausgehen, dass unser Egon, als er vermutlich längst zu schwach war, die 112 auf seinem Festnetztelefon zu wählen, kaum bereit gewesen wäre, jenem Geniekult um den asketischen Eremiten zu huldigen. Das jedenfalls legt die Lektüre von Janosch Schobins essayistischer aber grundlegender Analyse eines Gefühlszustands nahe, der unsere Gesellschaft wahrscheinlich noch längere Zeit auf ungute Weise dominieren wird.

Von Ronald Düker
Ronald Düker ist Kulturwissenschaftler und Autor im Feuilleton der ZEIT. Er lebt in Berlin.
Inhaltsangabe des Verlags
Immer mehr Menschen leiden unter Einsamkeit: ein Megathema unserer Gesellschaft, nicht erst seit Corona
John hat den Tod seiner Eltern nie überwunden und stürzt in die Einsamkeit. Marta leidet unter der Gewalt ihres Mannes und zieht sich aus der Welt zurück. Dolores hat als Sängerin den Weg aus der Armut auf die Bühne gefunden, wird dabei aber ihrer Familie fremd. Einsamkeit kennt viele Ursachen und Ausprägungen. Nicht erst seit Corona leiden immer mehr Menschen darunter, allein zu sein. Vor kurzem hat die Bundesregierung eine Strategie gegen Einsamkeit auf den Weg gebracht. Was hat sich verändert in unserer Gesellschaft? Steigt mit der Freiheit, das Leben selbst zu bestimmen, das Risiko, zu vereinsamen? Janosch Schobin hat das Buch der Stunde geschrieben: für alle, die verstehen wollen, was es mit diesem schmerzlichen Gefühl auf sich hat.
(Text: Hanser Berlin)